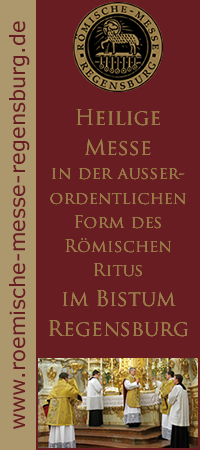Liturgie als Ausdruck des Glaubens und christlicher Vitalität – Teil II

Moderne Liturgiewissenschaft sieht sich zwei Versuchungen ausgesetzt, nämlich zu verkümmern entweder zur reinen Liturgiegeschichte oder zum theoretischen Begründungsversuch einer bloß noch kreativen, oft völlig momenthaft-spontanen Gottesdienstpraxis. Wie kann, gerade im Lichte liturgischer Überlieferungsprozesse, Liturgie wieder als lebendiger locus theologicus zurückgewonnen, also auch ein mechanistisch-formalistischer Rubrizismus als entgegengesetzte Sterilität vermieden werden?
Diese Frage spricht mich nun als Liturgiewissenschaftler an. In einer bahnbrechenden Abhandlung hat der in Rom lehrende Theologe Ralph Weimann – aufbauend auf Guardini und Ratzinger – nachgewiesen, wie beide in Ihrer Frage angesprochenen Versuchungen zur Verkümmerung ihre Wurzel in einem postmodernen Denken haben, das von der Regel des Glaubens abweicht (vgl. hierzu R. Weimann, Verschiedenheit der Formen und die Einheit in der Liturgie. Lex celebrandi als Spiegelbild der lex credendi, in: M. Graulich [Hg.], Zehn Jahre Summorum Pontificum. Versöhnung mit der Vergangenheit – Weg in die Zukunft, Regensburg 2017, 86-116).
Der Glaube aber ist entscheidendes Lebensprinzip der Kirche und ihrer Liturgie; das habe ich im ersten Teil unseres Gesprächs im Blick auf Kardinal Scheffczyk bereits anklingen lassen. Damit wird die Vitalitätsfrage angesprochen. An ihr entscheidet sich die Zukunft des Christentums innerhalb der säkularisierten Gesellschaft. Liturgie kann als locus theologicus, also als Quelle theologischer Erkenntnisbildung, nur dann zugkräftig zurückgewonnen werden, wenn man überhaupt das wahre Leben im Glauben sucht und daher in der Glaubensbegründung wieder eine unverzichtbare Vitalitätsquelle entdeckt. Wir fragen aber zu wenig nach dem wahren Leben (im johannäischen Sinn), weil das Etabliertsein im Hafen eigener Überzeugungen und Gewohnheiten zu überwiegen scheint – sowohl in traditionsverbundenen als auch in liberalen Kreisen. Das bringt letztlich auch Kommunikation zum Stillstand.
Welche Rolle messen Sie dabei – vor dem Horizont Ihrer eigenen Erfahrung als Priester und Liturge – dem Usus antiquior (der ‚außerordentlichen Form‘ des römischen Ritus) zu?
Mittlerweile ist solide nachgewiesen, dass es vor der Liturgieumstellung infolge des Zweiten Vatikanums in der gesamten Tradition keinen vergleichbaren Vorgang gegeben hat – unbeschadet aller Wandlungen im Laufe der Liturgiegeschichte. Positiv gewendet besagt dies ein wichtiges inneres Merkmal der überlieferten Liturgie, vielleicht sogar das zentralste überhaupt: ihre Umbruchsfreiheit – wenn man ‚Umbruch‘ als eine bewusst in kurzer Zeit herbeigeführte und das Ganze betreffende Änderung versteht. Diese Umbruchsfreiheit ist in keiner Weise mit Erstarrung in einem bestimmten historischen Zustand zu verwechseln, wie sie der traditionellen Liturgie oft in übertriebenem Maß vorgeworfen wird. Im Lichte des zuvor Angesprochenen bedeutet Umbruchsfreiheit aber Ungebrochenheit eines Vitalitätsstroms, für den in Rückschau keine Grenzmarke erkennbar ist, die ihn vom geschichtlichen Ursprung trennen würde, zuletzt auch nicht vom Christusereignis. Dies ist der überlieferten Gestalt der Liturgie innerlich.
Die Kraft zur Glaubensbegründung (als locus theologicus) wohnt ihr daher in einem ganz fundamentalen Sinne inne. Darin, dass sie dies rituell vollzieht, liegt die tiefste Wurzel ihrer Kultkraft. Weil demgegenüber die nachkonziliare Liturgie eine grundlegend andere Vitalitätsstruktur hat, kann sie diese ‚alte‘ Vitalität (die selbstverständlich mit sakramentaler Gültigkeit nicht zu verwechseln ist) nicht erbringen. Deshalb bleibt die Praxis der überlieferten römischen Liturgie, wenn man so will, auch auf ‚gnadenhafter‘ Ebene für das gesamte Leben der Kirche unverzichtbar – weit mehr als allgemeinkirchlich wahrgenommen wird: Die ganze Kirche sollte dankbar dafür sein. Es ist deshalb unsinnig, den Usus antiquior als ‚konservativ‘ anzusehen. Auch die Kathetrale von Chartres könnte man ja nicht als ‚konservativ‘ bezeichnen.
Solche Etikettierungen werden an einen Ritus rein äußerlich herangetragen – einerseits aus dem puren Faktum einer zeitlich ‚neueren‘ Gestalt römischer Liturgie (was nicht viel besagt), zum anderen aber leider auch bei manchen Vertretern des Usus antiquior selbst durch Beharrung in einer nur zeitbedingten und heute überholten Art seiner Praxis. Von alldem muss aber die in Gebeten und Rubriken greifbare Identität gewachsener Liturgie unterschieden bleiben. In dieser liegt, wenn man so will, ihre stille und wehrlose Unschuld, der aber auch in vergangenen Zeiten oft arg zugesetzt wurde, man denke etwa an moralisierenden Rubrizismus (was wiederum einen Drang im 20. Jahrhundert zur Liturgiereform relativ nachvollziehbar macht).
Sie sprechen von unterschiedlichen Vitalitätsstrukturen und von Kultkraft. Können Sie dies noch erläutern?
Die ‚alte‘ Vitalität könnte man vielleicht beschreiben als einen Segen, der auf einer gewachsenen und ungebrochen sich entwickelnden rituellen Gestalt ruhen bleibt – etwa wie das ‚Eingebetet-Sein‘ einer uralten Klosterkirche, das ja von den Menschen auch intuitiv wahrgenommen wird. Das ist keine Kleinigkeit, wenn man den Stellenwert der Liturgie als locus theologicus mitbedenkt. Die ‚neue‘ Vitalität, also jene der nachkonziliaren Art der Liturgie, setzt hingegen bei der Kommunikation zwischen der liturgischen Dienerschaft und der übrigen Gottesdienstversammlung an. Ein darauf fixierter Wirklichkeitszugang kann an der überlieferten Liturgie freilich nur einseitig eine Schwachstelle erkennen. Im Usus recentior (der ‚ordentlichen Form‘ des römischen Ritus) wird der interkommunikative Bezug zum zentralen Anliegen der Gestalt, mit Öffnung auch für die affektiv-spontane Ebene. So wird Vitalität menschlich erlebbar.
Der Unterschied zwischen beiden Vitalitätsarten lotet in tiefe Abgründe hinab. Die ‚alte‘ Vitalität vermittelt sich an dem, was noch die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums als theologisches Hauptmerkmal der Liturgie betont hat: dass sie „in vorzüglichem Sinne heilige Handlung“ (actio sacra praecellenter) ist (SC 10). Rein dogmatisch gesehen, ist dies in der neuen Liturgie um ihrer sakramentalen Gültigkeit willen zwar auch gegeben. Aber ihre Gestalt und ihr Erlebnisschwerpunkt – um mich einmal so auszudrücken – betonen konsequent und aus erklärtem Willen der Reformer den Aspekt einer gemeinsamen Feier der Ortsgemeinde, also eines Miteinanders aller um (bzw. vor) Altar und Ambo, und lassen die ‚heilige Handlung‘ Funktion an dieser Feier sein.
Wie stark schlägt sich dies im Unterschied ritueller Gestalt nieder?
Ich will mich in diesem Rahmen auf eine Beobachtung beschränken. Der Unterschied lässt sich in der Messe bis hinein in die neue Gestalt der zentralen sakramentalen Worte erkennen: Im Usus antiquior sind diese Worte „Konsekrationsworte“ (verba consecrationis) und beschränken sich daher genau auf jene Worte, die tatsächlich die Wandlung beinhalten und bewirken. Es hat mich persönlich tief getroffen, als ich dies 2007 erstmals beim Zelebrieren erfahren durfte. Demgegenüber gestaltet die nachkonziliare Form der Liturgie die zentralen Worte zu verba Domini aus (also zu „Herrenworten“): Diese umfassen auch den Befehl „Nehmet und esst/trinkt“ sowie den Wiederholungsauftrag „Tut dies zu meinem Gedächtnis“, sind also ‚Gesamtworte‘und stellen somit das (gemeinsame) Gedächtnis an Jesu Abendmahlshandlung über den priesterlichen Konsekrationsakt.
In der Konsequenz liegt, dass sie nicht nur still über die Gaben gesprochen werden, sondern zugleich den Anwesenden vernehmlich – in natürlich-gesprochenem und daher immer auch affektivem Tonfall – verkündet werden. Die eigentliche Konsekration als sakramentaler Akt geht darin harmonisch auf. In dieser Linienführung steht, dass dies – über die zentralen Worte hinaus – auch insgesamt nach Abwechslung strebt und eine Mehrzahl neuer Hochgebete hervorgebracht hat. In alldem liegen freilich auch Chancen für heutige Evangelisierung, gerade auch was die affektive Dimension betrifft. Doch diese braucht (weit mehr als uns bewusst ist) die Kenntnis der alten Ordnung der Konsekration, um sich frei von persönlichem Geschmack etwa bezüglich des Stimmfalls zu halten. So bleibt die Chance des Neuen (die im Alten selbst kaum gegeben ist) angewiesen auf eine auch empathische Kenntnis und Bejahung des Alten. Die ‚neue‘ Vitalität hängt überhaupt in ihrer Möglichkeit von der ‚alten‘ ab. Von dieser Einsicht sind wir derzeit leider vielfach noch weit entfernt.
Haben Sie hier einen Wunsch?
Selten, dass man Raum zugestanden bekommt, sich dazu öffentlich zu äußern, danke. Um offen zu sein: Ich halte es für unnatürlich und auch für schädlich im Blick auf die Einheit der Kirche, wenn die Befürworter sowohl des Usus antiquior als auch des Usus recentior weiterhin an der Meinung festhalten, eines Eingehens auf den jeweils anderen Usus nicht zu bedürfen. Was soll das für ein Christsein in der Gegenwart sein, das meint, kein vitales Interesse an liturgischer Tradition aufbringen zu müssen? Hier fehlt es offenbar an demütiger Selbstzurücknahme, die anerkennt, dass Liturgie als locus theologicus nur in bruchlos gewachsener liturgischer Gestalt verankert sein kann. Das kann eine Liturgie, die als eine und ganze auf eine bewusste Liturgiereform zurückgeht, nun einmal nicht erbringen. Doch auch umgekehrt: Was soll das für eine Traditionsverhaftung sein, die meint, sich eine Empathie mit dem Faktum der weltweit überwiegenden liturgischen Ordnung kurzerhand sparen zu können? Kann der kulturgeschichtliche Wandel im Symbol- und Kultbezug vieler (vor allem westlicher) Menschen so ausgeblendet werden? Diese Frage macht den Usus antiquior keineswegs überholt, freilich nur in dem Maße, als – unbeschadet der Treue zu seiner Gestalt – seine konkrete Praxis sich dieser Frage wirklich stellt.
Bewusst habe ich zu vorangehenden Fragen einmal mit dem Blick auf Vitalität zu antworten versucht. Nur darüber will ich hier sprechen; wieweit darüber hinaus auf sachlicher Ebene Neues an Altes verweisen und entsprechend beurteilt werden muss, ist eine fachliche Fragestellung, die zwar wichtig bleibt, die ich aber bewusst einmal zurücktreten lassen will, um im Verhältnis von fides und ratio dem wahren Leben christlicher Existenz eine Chance zu geben: Denn wenn wir dies vernachlässigen, nützt uns das Fachliche auch nichts mehr, und Kontroversen werden endlos. Wir haben zwei tiefgehend verschiedene liturgische Usus mit jeweils sehr unterschiedlicher Vitalitätsstruktur, aber damit auch mit verschiedener Vitalitätsmöglichkeit. Beides lässt sich nicht vereinen, beides kann die je eigene Identität nicht in ein (künftiges) Drittes aufheben.
Aber genau deshalb kann sich beides umso mehr (auf gnadenhaft-lebenspendender Ebene) ergänzen. Ich wünsche mir von beiden Seiten mehr Freude an jener Vitalität, welche die jeweils andere Seite ins Leben der Kirche einbringen kann, als Furcht vor deren Anderssein. Daran bewahrheitet sich, dass der Glaube überhaupt an erster Stelle steht. Anstatt im Anderen immer nur Bedrohung des je eigenen zu wittern und das Gespenst tiefgehender Richtungsunterschiede heraufzubeschwören, wünsche ich mir eine frohe, dankbare, unvoreingenommene Offenheit für die Dimension der Vitalität in beide Richtungen, die um der Kirche willen nach dem wahren Leben umfassend strebt und deshalb nicht danach schielt, wie weit und wann die andere Seite mit dieser Offenheit anfängt.
Lieber Pater Nebel, Kathnews freut sich, dass Sie sich zu diesem Interview bereiterklärt haben und bedankt sich vielmals für den anregenden Gedankenaustausch mit Ihnen.
Hier gelangen Sie zu Teil I des Interviews.
Foto: Pater Dr. Johannes Nebel FSO – Bildquelle: Privatarchiv