Mysterium Paschae: Kreuzesgeheimnis als innere Voraussetzung der Auferstehung
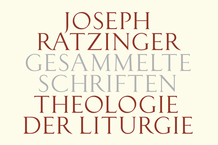
Im ersten Teil dieser Vorstellung des Liturgiebandes der Gesammelten Schriften Joseph Ratzingers habe ich vor allem versucht, Ratzingers Zugang zur Liturgie fĂŒr den eigenen Mit- und Nachvollzug der Leser zu erschlieĂen. Ratzingers Interesse ist dabei weder unmittelbar praktisch, noch rein geschichtlich. Im geschichtlichen Werden spĂŒrt er Grundelemente und Grundstrukturen auf, von denen er ĂŒberzeugt ist, dass sie fĂŒr das Wesen des christlichen Gottesdienstes gĂŒltig und deshalb fĂŒr seine Gestalt auch heute und in Zukunft maĂgeblich bleiben. Eine MaĂgeblichkeit, die theologisch und anthropologisch zugleich ist, sie meint die rechte Weise der Begegnung des Menschen mit Gott und die Antwort, mit der der Mensch der Zuwendung und dem Anruf Gottes entspricht, um so seiner eigenen und eigentlichen Bestimmung zu entsprechen. Diese Ausrichtung ist es, die die Liturgie fĂŒr Ratzingers Theologie zentral werden lĂ€sst, und aus ihr erklĂ€rt sich, warum das gottesdienstliche Leben der Kirche und unsere Teilhabe daran nach Joseph Ratzinger fĂŒr eine christliche Existenz zentral ist. Diese existentielle Bedeutung bleibt nicht rein spekulativ, sondern ist ganz konkret, doch wird sich im folgenden zeigen, dass sie gerade deshalb letztlich konkreten Einzelfragen um Stil und Ăsthetik der liturgischen Feier ĂŒberlegen und entzogen ist.
Mehr Habitus als Ritus
Dieser Hinweis berĂŒhrt ein erstes Mal das Thema âReform der Reform“. WĂ€hrend des Pontifikats Benedikts XVI. blieb sie juristisch gesehen völlig vage, ja fand sie quasi ĂŒberhaupt nicht statt, wenn man vom Motu Proprio Summorum Pontificum (und seiner zugehörigen Instruktion) absieht, zumal dieses Motu Proprio die nachkonziliare Form der Römischen Liturgie nur indirekt betrifft. Selbst die Umsetzung der Anweisung, in den landessprachlichen Ausgaben des neuen Missale zur wortgetreuen Wiedergabe des „pro multis“ zurĂŒckzufinden, wurde von Benedikt XVI. nicht nachdrĂŒcklich verfolgt. Viele, die sich mit Ratzingers Theologie der Liturgie identifizierten (oder meinten, sie verstanden zu haben), argumentierten so, dass der Papst die âReform der Reform“ nicht durch Befehl, sondern durch sein Beispiel erreichen wolle und durch Ăberzeugungsarbeit.
BerĂŒcksichtigt man aber, was ich soeben sagte, mag es schon sein, dass Benedikt XVI. persönlich eine mehr klassische AusprĂ€gung auch der neuen Liturgie bevorzugt hat und damit auch deren KontinuitĂ€tsanspruch zur Geltung bringen wollte. Dass er aber deswegen die Nachahmung dieses Stils erwartet hĂ€tte, oder dass man sich fĂŒr eine solche Nachahmung wirklich auf sein Vorbild oder gar seinen Willen stĂŒtzen konnte, muss bezweifelt werden. Benedikts liturgische Haltung ist nicht unbedingt mit einer bestimmten liturgischen Ausdrucksform verbunden. Wer Ratzinger liest und sich dabei nicht nur die eigenen Lieblingsstellen herauspickt, findet fĂŒr diese Behauptung immer wieder Belege. Besonders deutliche davon werde ich etwas spĂ€ter noch anfĂŒhren.
Der Geist der Liturgie
In den Gesammelten Schriften Joseph Ratzingers werden seine Arbeiten jeweils zu einem bestimmten theologischen Themenkreis in einem Band zusammengefasst. Dabei werden sie allerdings nicht chronologisch aneinandergereiht, sondern in eine neu systematisierte Anordnung gebracht, die den Durchblick auf die im ganzen angezielte Aussage erleichtern soll. Der insgesamt gewonnene Gedanke soll aufscheinen, nicht sosehr der Weg und die Chronologie seiner Entwicklung im Denken Ratzingers nachgezeichnet werden. Aber auch, wer diese beiden nachvollziehen will, kann dies relativ bequem anhand der editorischen Hinweise und bibliographischen Nachweise (vgl. im hier besprochenen Band SS. 727-744) tun.
Den Arbeiten, in denen sich Joseph Ratzinger mit dem Gottesdienst und insbesondere mit der Feier der Eucharistie befasst, ist deshalb sein Buch âDer Geist der Liturgie“, das zuerst im Jahr 2000 erschienen ist, sozusagen als Grundlagentext vorangestellt. Gleichzeitig kann man in dieser Anlage soetwas wie die Quintessenz und Frucht aller glĂ€ubigen und denkerischen BemĂŒhungen Ratzingers um die Liturgie erblicken. Dies erkennt man daran, dass dieses Buch weniger eine fachtheologische Arbeit als vielmehr ein Impuls an ein breiteres Publikum von am Thema geistlich Interessierten ist.
Fehldeutungen ausrÀumen
Das neuerliche Erscheinen dieses Werkes im Rahmen der Gesammelten Schriften veranlasste Benedikt XVI., in seinem Vorwort zum Liturgieband âZum Eröffnungsband meiner Schriften“ an den Lesern und Rezensenten des ursprĂŒnglich selbstĂ€ndig erschienenen Buches eine Kritik und Korrektur zu ĂŒben, an der sich meines Erachtens sehr schön zeigen lĂ€sst, dass es Benedikt XVI. bei dem, was er selbst unter âReform der Reform“ verstand, im wesentlichen nicht um eine verpflichtende Ăbernahme oder Nachahmung seines eigenen liturgischen Stils als Papst ging.
Er schreibt: âLeider haben fast alle Rezensenten sich auf ein einziges Kapitel gestĂŒrzt: Der Altar und die Gebetsrichtung in der Liturgie. Die Leser der Rezensionen mussten schlieĂlich meinen, das ganze Werk handle nur von der Zelebrationsrichtung; sein Inhalt sei es, wieder die Messfeier ‚mit dem RĂŒcken zum Volk‘ einfĂŒhren zu wollen. Angesichts dieser Entstellung habe ich einige Zeit daran gedacht, dieses Kapitel – neun von insgesamt 200 Seiten – zu streichen, damit endlich das Eigentliche zur Sprache kommen könne. (…) Die wesentliche Absicht des Werkes war es, die Liturgie ĂŒber die oft kleinlichen Fragen nach dieser oder jener Form hinaus in ihren groĂen Zusammenhang zu stellen. (…) Da ist zunĂ€chst das innere Zueinander von Altem und Neuem Testament; ohne den Zusammenhang mit dem alttestamentlichen Erbe ist die christliche Liturgie schlechterdings nicht zu verstehen. Der zweite Kreis ist die Beziehung auf die Religionen der Welt. Und schlieĂlich kommt der dritte Kreis hinzu: der kosmische Charakter der Liturgie. (…) Dies war in der Ostrichtung des Gebetes gemeint: dass der Erlöser, zu dem wir beten, auch der Schöpfer ist und so in der Liturgie immer auch die Liebe zur Schöpfung und die Verantwortung fĂŒr sie enthalten bleibt. Ich wĂŒrde mich freuen, wenn die neue Ausgabe meiner liturgischen Schriften dazu beitragen könnte, dass die groĂen Perspektiven unserer Liturgie gesehen und kleinliche Streitigkeiten um Ă€uĂere Formen an ihren rechten Platz verwiesen werden“ (ebd., SS. 6-8).
Diesen drei zentralen und gewissermaĂen auch konzentrischen Kreisen im Themenbereich Liturgie bei Ratzinger werde ich in den Teilen dieser Besprechung, die sich anschlieĂen, genauer nachgehen. Erhellend fĂŒr Ratzingers Vorstellung vom Zustand der alten Liturgie vor dem Zweiten Vaticanum ist das Bild eines ĂŒberlagerten Freskos, das dadurch zwar intakt bewahrt wurde, zugleich aber – wie unter einer Schutzschicht zwar – verborgen unzugĂ€nglich blieb (vgl. ebd., S. 30). Wörtlich fĂ€hrt er fort: âDurch die Liturgische Bewegung und definitiv durch das II. Vatikanische Konzil wurde das Fresko freigelegt, und einen Augenblick waren wir fasziniert von der Schönheit seiner Farben und Figuren. Aber inzwischen ist es durch klimatische Bedingungen wie auch durch mancherlei Restaurationen und Rekonstruktionen gefĂ€hrdet und droht zerstört zu werden, wenn nicht schnell das Nötige getan wird, um diesen schĂ€dlichen EinflĂŒssen Einhalt zu gebieten. NatĂŒrlich darf es nicht wieder ĂŒbertĂŒncht werden, aber eine neue Ehrfurcht im Umgang damit, ein neues Verstehen seiner Wirklichkeit und seiner Aussage ist geboten, damit nicht die Wiederentdeckung zur ersten Stufe des definitiven Verlustes wird“ (ebd., SS. 30f).
Freigelegtes Fresko
Dieses Bild ist gut gewĂ€hlt, zeigt aber meines Erachtens zugleich auch die Grenze und BeschrĂ€nkung des ratzingerischen Problembewusstseins und folglich seines Konzeptes wie seiner Absicht zu einer âReform der Reform“ an: Sicherlich hatte die vorkonziliare Liturgische Bewegung in ihren besten Vertretern das Fresko der Liturgie freigelegt, und man wird auch zugestehen können, dass die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils in weiten Passagen dieses Konzilsdokuments diese Freilegung als Leistung definitiv anerkannt und positiv gewĂŒrdigt hat. Was jedoch die nachkonziliare Liturgiereform brachte, war doch eher bereits die Zerstörung des Freskos, aus dessen Fragmenten bestenfalls ein neues Mosaik zusammengefĂŒgt wurde oder von dem ĂŒberhaupt nur Restelemente fĂŒr die Schaffung einer neuen Collage verwendet wurden.
Ratzinger wollte das zumindest nie deutlich sehen. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass sein Konzept einer âReform der Reform“ sozusagen im Ansatz steckenbleiben musste, und wenn man nicht ĂŒber âdiese oder jene Form“ diskutieren soll, weil dies den Weg versperrt, zur eigentlichen Gestalt der Liturgie zu gelangen, dann ist es auch blockierend, eine ordentliche und eine auĂerordentliche oder eine Ă€ltere und eine neuere Form des Ritus Romanus zu unterscheiden und keineswegs ein erster Schritt zu echter Reform oder zur Versöhnung dessen, was unversöhnlich ist. Das soll nicht besagen, eine âReform der Reform“ mĂŒsse oder könne in einem ersten Schritt nur in einer pauschalen Annullierung der sogenannten ordentlichen Form des Römischen Ritus bestehen. Jeder weiĂ, dass dies nicht möglich ist. Eine âReform der Reform“, die im ĂuĂerlichen oder im Stil verbleibt, bringt nichts oder wĂŒrde auf ihre Weise die Defizite der neuen Liturgie ebenfalls nur ĂŒbertĂŒnchen und verdecken. Solange diese Einsicht fehlt, ist jede weitere Diskussion mĂŒĂig, aber auch jede âwechselseitige Befruchtung“, die sich Benedikt XVI. mit Summorum Pontificum vielleicht ehrlich erhofft haben mag, entweder unmöglich, oder aber kontraproduktiv.
Theologie der Liturgie
Gesammelte Schriften â Band 11
Joseph Ratzinger
Verlag Herder
758 Seiten
Leinen mit Leseband
Bestell-Nr.:4299475
ISBN: 978-3-451-29947-6
Preis: 55,00 Euro
Foto: J. Ratzinger â Gesammelte Schriften â Theologie der Liturgie â Bildquelle: Verlag Herder










