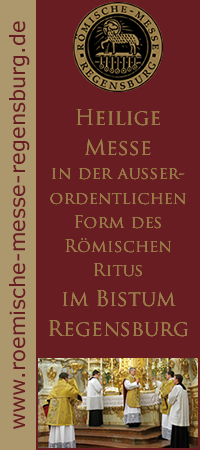Neue Analogie zum Monophysitismus oder Catholic Amish People?

Sollten die Einigungsbem√ľhungen der Priesterbruderschaft St. Pius X. mit Rom doch noch scheitern,¬† wird gewiss auch aufseiten des Heiligen Stuhls ein Bed√ľrfnis der Rechtfertigung entstehen, die nicht zustande gekommene Einigung nicht nur formal, also mit dem Vorwurf einer schismatischen Haltung bei der Piusbruderschaft zu begr√ľnden. Die Ablehnung, die zuletzt vorgelegte Lehrm√§√üige Pr√§ambel vom 13. Juni 2012 zu unterzeichnen, k√∂nnte zwar nicht mehr nur als eine latent schismatische Tendenz, sondern – auch ohne neuerliche Bischofsweihen bei fehlendem Apostolisches Mandat oder gegen p√§pstliches Verbot – als der klare Ausdruck der konsequent vollzogenen Weigerung, sich der hierarchischen Struktur der Kirche ein- und unterzuordnen, ausgelegt und zum vollendeten, formellen Schisma erkl√§rt werden.
Blo√ü materieller und deshalb steriler Traditionsbegriff als k√ľnftige H√§resie?
Gerade aus Gr√ľnden der √∂kumenischen Glaubw√ľrdigkeit, die nat√ľrlich nur unangefochten bestehen kann, solange Rom sich nicht nur um √úberwindung bestehender Spaltung der Christenheit bem√ľht, sondern sich erst recht engagiert, neue Trennungen von der katholischen Kirche, von der Kirche Roms, zu vermeiden und vor allem nicht selbst zu provozieren, wird die Glaubenskongregation sich zweifellos bem√ľhen, bei der Piusbruderschaft und ihren Gl√§ubigen ein inhaltliches Motiv f√ľr die Trennung zu benennen und eine theologische Fehlhaltung, einen lehrm√§√üigen Irrtum oder direkt eine lef√®bvrianische H√§resie nachzuweisen. Wenn auch der Pr√§sident des P√§pstlichen Einheitsrates, Kurt Kardinal Koch, am 31. Juli 2012 in vergr√∂bernder Argumentation bereits eine Parallele zwischen der Konzilskritik Luthers und derjenigen Lef√®bvres ziehen wollte, wird man wohl kaum ein ‚Äěsola traditione‚Äú als Inhalt dieser Irrlehre angeben. Das w√§re viel zu einfach und theologisch naiv gedacht.
Rufen wir uns aber das Motu proprio Ecclesia Dei afflicta mit seiner Nr. 4 ins Ged√§chtnis, w√§re es eine wahrscheinliche M√∂glichkeit, dass man bei einem defizit√§ren Traditionsbegriff ansetzt, von dem man sagen wird, dass er ‚Äěden lebendigen Charakter der Tradition nicht genug ber√ľcksichtigt‚Äú. Das k√∂nnte der Fall sein, wenn die Piusbruderschaft unter der Tradition tats√§chlich ausschlie√ülich den Aspekt des inhaltlichen,¬† apostolischen Abschlusses der Offenbarung Jesu Christi verstehen w√ľrde und den pneumatischen Aspekt des Prozesses der Weitergabe dieses, in sich vollst√§ndigen, Inhalts in Lehramt und Glaubenssinn der jeweils aktuellen Kirche wirklich ganz √ľbersehen oder aber prinzipiell und pauschal behaupten wollte, dieser pneumatische Beistand, der der Kirche ja w√§hrend ihrer gesamten Geschichtsdauer verhei√üen ist, sei bei oder sp√§testens nach dem II. Vatikanischen Konzil grunds√§tzlich unterbrochen worden und nur durch entschiedene und vollst√§ndige Abkehr von den Lehren und Reformen dieses Konzils k√∂nne er wieder erlangt werden.
Aber dieser Nachweis kann f√ľr die Piusbruderschaft redlich nicht stringent gef√ľhrt werden, nachdem ihr Generaloberer, Weihbischof Bernard Fellay, schon 2001 klargestellt hat, dass seine Gemeinschaft bei 95% der Aussagen des II. Vatikanischen Konzils kein Problem sieht, zuzustimmen. Au√üerdem¬† hat die Piusbruderschaft nie die Haltung jener Traditionalisten geteilt oder auch nur in ihren Reihen geduldet, die die Legitimit√§t der Konzilsp√§pste und der nachkonziliaren P√§pste und Bisch√∂fe bestreiten.
‚Pneumatische Unterbrechung’ als der eigentliche ekklesiologische Irrtum?
Die sogenannten Sedisvakantisten vertreten wohl in der Tat eine Theorie der ‚Äěpneumatischen Unterbrechung‚Äú mit und seit Vaticanum II, die schon nicht mit der Lehre der Heiligen Schrift, aber auch nicht mit dem Traditionsdekret des Konzils von Trient vereinbar ist. Insofern die Sedisvakantisten nur den Aspekt der materiellen Vollst√§ndigkeit und Abgeschlossenheit der Offenbarung als die Tradition zu betrachten scheinen, das authentische Lehramt und den Glaubenssinn der Kirche seit Vaticanum II hingegen pauschal als de facto erloschen ansehen oder den Glaubenssinn nur noch bei sich selbst am Werke glauben, kann man den Sedisvakantisten den skizzierten,¬† defizit√§ren Begriff¬† von Tradition vermutlich zu Recht zuschreiben. Angesichts der Zersplitterung des Sedisvakantismus zu rivalisierenden Kleinstgruppen oder √ľberhaupt zu Home-aloners ist zudem gerade bei ihnen der sensus fidelium wahrscheinlich am allerwenigsten vorhanden.
Materiell ist die Offenbarung Jesu Christi als Apostolische Tradition vollst√§ndig und inhaltlich vollendet, als pneumatischer Prozess der Weitergabe ist sie jedoch authentisch in Lehramt und Glaubenssinn lebendig. Ein vollst√§ndiger, zutreffender Traditionsbegriff umfasst beide Aspekte: inhaltliche Vollst√§ndigkeit und apostolische Abgeschlossenheit oder besser: Vollendung, authentische, pneumatisch verb√ľrgte Weitergabe dieses Inhalts als lebendiger Prozess, dessen Subjekt die Kirche in ihrem Lehramt und Glaubensinn permanent ist. Ein orthodoxer, rechtgl√§ubiger, Traditionsbegriff muss dyoparadosal ¬†(gebildet aus den altgriechischen Worten f√ľr die Zahl ‚Äězwei‚Äú [Griechisch: dyo) ¬†und f√ľr ‚ÄěTradition/√úberlieferung‚Äú [Griechisch: paradosis] und mit dem Suffix ‚Äě-al‚Äú zum Eigenschaftswort gestaltet) sein.
Von diesem, von uns als rechtgl√§ubig bestimmten, dyoparadosalen Verst√§ndnis von Tradition ausgehend, ¬†soll die Begriffsbildung n√§her erl√§utert werden, damit sich nicht neue Missverst√§ndnisse des rechten Traditionsbegriffs ebenso, wie¬† √ľber seine – anschlie√üend einzuf√ľhrende, traditionalistisch-h√§retische Verzerrung – einstellen. ‚ÄěDyo-‚Äú ist nicht etwa den zwei Quellen der Offenbarung geschuldet: Heilige Schrift und Tradition, wobei wir an das Verst√§ndnis des Konzils von Trient erinnern m√∂chten, das ja insgesamt vier Modi unterschieden hat, in denen der Kirche, in ihr und somit durch die Kirche die Offenbarung tradiert und vergegenw√§rtigt wird.
„Dyo-‚Äú nimmt vielmehr Bezug auf die beiden Aspekte der einen Tradition, der einen Paradosis. ‚ÄěDyo-‚Äú entspricht zum einen der inhaltlichen, apostolisch vollendeten und in diesem Sinne abgeschlossenen, Seite der Tradition, zum anderen ihrem lebendigen Charakter, den sie als Weitergabe logischerweise immer besitzen muss. Wir sprechen deshalb auch nicht von einem ‚Äědyoparadosen‚Äú Standpunkt, so als ob es zwei Paradosen, zwei Traditionen, g√§be, sondern charakterisieren die rechtgl√§ubige Position als ‚Äědyo-parados-al‚Äú, insofern die eine Tradition zwei Aspekte in sich vereint, zwei Eigenschaften hat: ihre inhaltlich abgeschlossene, apostolische Vollendung, die dem Gehalt der Offenbarung entspricht, sowie die zweite Eigenschaft der Lebendigkeit als Weitergabe. Diese Lebendigkeit ist auch nicht diejenige einer rein menschlichen √úberlieferung, sondern wird in der Kirche zuallererst vom Heiligen Geist selbst bewirkt, ist pneumatisch.
Eine traditionalistische H√§resie k√∂nnte folglich entstehen, wenn der erstgenannte, inhaltliche Traditionsaspekt, der an sich gewiss zutreffend und sogar unerl√§sslich ist, isoliert und verabsolutiert wird. Was sich so ergeben w√ľrde, k√∂nnte man beispielsweise ‚Äěanti-pneumatischen Monoparadosalitismus‚Äú nennen. Eine solche H√§resie kann man, wie gesagt, im Sedisvakantismus stark vermuten und muss sie als seine letzte Konsequenz bef√ľrchten; der theologischen Position der Priesterbruderschaft St. Pius X. aber w√ľrde dieser Vorwurf Unrecht tun. Das hei√üt leider nicht, dass es ¬†innerhalb der Bruderschaft keine monoparadosalitischen Versuchungen und Str√∂mungen g√§be, die vermutlich zu einer solchen Sichtweise tendieren oder dass sie faktisch von theologisch unreflektierten Gl√§ubigen, die die Seelsorge der Piusbruderschaft in Anspruch nehmen, vertreten wird.
Realistisch muss man indes damit rechnen, Gl√§ubige, die zumindest unbewusst eine solche Haltung ‚Äď m√∂glicherweise etwas gemildert ‚Äď einnehmen, auch im Umfeld der Ecclesia-Dei-Gemeinschaften zu finden. Die monoparadosalitische Position ist aber in dieser abgeschw√§chten Form weit weniger theologisch begr√ľndet oder durchdacht, sehr viel eher psychologisch bedingt und Ausdruck einer vermutlich sogar ziemlich weit verbreiteten, allgemeinen Mentalit√§tstendenz traditionsverbundener Personenkreise.
Das entgegengesetzte Missverständnis des Modernismus: eine inhaltlich unvollendete, vitalistische Überlieferung
¬†Der lebendige Charakter der Tradition kann aber auch missverstanden werden, indem der zweite Aspekt zum Alleinstellungsmerkmal der √úberlieferung erkl√§rt wird, in der Weise, dass man meint, die Offenbarung Jesu Christi sei inhaltlich nicht apostolisch abgeschlossen und vollst√§ndig, sondern die Offenbarungsgabe k√∂nne oder m√ľsse sogar im Prozess ihrer geschichtlichen Weitergabe seitens der Kirche unter dem pneumatischen Beistand des Heiligen Geistes fortgesetzt angereichert werden oder auch –¬† in extremster Form als st√§ndige Regeneration verstanden ‚Äď vermeintlich veraltete Inhalte unabl√§ssig ausscheiden. Im Gegensatz dazu kann der in sich vollst√§ndige und in seiner Heilsrelevanz in Jesus Christus personal ausgerichtete Offenbarungszusammenhang in Wahrheit nie veralten, sondern ist in der Gestalt seiner Apostolizit√§t bleibend vollkommen und in der Kirche pneumatisch gegenw√§rtig.
Durch Isolation und Absolutsetzung wird auch der zweite Traditionsaspekt verf√§lscht und leistet einer Ansicht Vorschub, die¬† analog zum traditionalistischen Monoparadosalitismus als modernistische H√§resie aufzufassen w√§re, die man treffend beispielsweise ‚Äěpneumatistischen Traditionsvitalismus‚Äú oder noch pr√§ziser: ¬†‚Äěpneumatistischen Revelationsvitalismus‚Äú nennen k√∂nnte. Man beachte hier, dass wir dieser Position nicht das Adjektiv pneumatisch zubilligen k√∂nnen, sondern sie pneumatistisch nennen m√ľssen, um die Einseitigkeit anzudeuten, die zum Revelationsvitalismus f√ľhrt, indem er unausgesprochen in letzter, logischer ¬†Konsequenz von einer eigenen Offenbarung des Heiligen Geistes w√§hrend der gesamten Geschichtsdauer der Kirche ausgeht, die neben der Offenbarung Jesu Christi stehen und diese komplettieren soll, vermeintlich erg√§nzen kann oder vielleicht sogar erg√§nzen muss.
Die griechische Vorsilbe ‚Äěmia-‚Äú bezeichnet eine komplexe Einheit aus zwei oder mehreren Aspekten, und zu ihrer Rechtfertigung werden pneumatistische Revelationsvitalisten vielleicht einwenden, sie seien gar keine solchen, sondern die beiden Aspekte der Tradition, n√§mlich ihre inhaltliche Vollendung und Vollst√§ndigkeit sowie ihre Lebendigkeit als Vorgang der √úbermittlung, seien so untrennbar voneinander, dass sie eine innige, subtile Einheit bilden und die rechtgl√§ubige Position genaugenommen daher kein pneumatischer Dyoparadosalitismus sein k√∂nne, sondern pneumatischer Miapradosalitismus sein m√ľsse. Sie, die als pneumatistische Revelationsvitalisten Kritisierten, seien in Wahrheit gerade dies: pneumatische Miaparadosaliten.
Diese Erwiderung hat auf den ersten Blick etwas Gewinnendes, und man könnte sie richtig verstehen, doch liegt das Problem des Traditionsbegriffs ja gerade in der Tendenz, die beiden Aspekte der einen Tradition nicht ausreichend zu unterscheiden. Praktisch dominiert daher vermutlich schon längst ein wenigstens semi-pneumatistischer Revelationsvitalismus. Deswegen muss gerade heute nicht die Einheit beider Aspekte betont, sondern ihre formale, aber eben nicht bloß formale, Unterscheidung voneinander zum Ausdruck gebracht werden. Aus diesem Grund gilt der Einwand nicht und bleibt die Begriffsprägung des pneumatischen Dyoparadosalitismus berechtigt und einzig sachgerecht.
Kirchenv√§ter als Konzilskritiker ‚Äď ausreichender historischer Abstand als Bedingung g√ľltiger Konzilsw√ľrdigung
Es ist Joseph Ratzinger gewesen, der bald in der unmittelbaren Nachkonzilszeit des II. Vaticanums ¬†einen Beitrag ‚Äězur Ortsbestimmung von Theologie und Kirche heute‚Äú zu leisten versucht hat. ¬†Momentan ist dieser Beitrag als Epilog zu Ratzingers Theologischer Prinzipienlehre, die den Untertitel: Bausteine zur Fundamentaltheologie tr√§gt, am leichtesten greifbar. Wir zitieren nach der Ausgabe der Prinzipienlehre, die 2005 im M√ľnchner Verlag Wewel erschienen ist. Dort findet sich die ‚ÄěOrtsbestimmung‚Äú auf den Seiten 381-411.
2012 begehen wir bald den 50. Jahrestag der Eröffnung des II. Vatikanischen Konzils:
In seiner ‚ÄěOrtsbestimmung‚Äú erw√§hnt Ratzinger die Konzilskritik eines Gregor von Nazianz etwa 50 Jahre nach dem Konzil von Nik√§a, die dessen Freund und Weggef√§hrte¬† Basilius von C√§sarea noch versch√§rft, und Ratzinger akzeptiert diese Einsch√§tzungen als berechtigt,¬† um dann aus dem Abstand der Jahrhunderte anzuschlie√üen: ‚ÄěAus einer Art von makroskopischer Sicht der Geschichte, mit der wir von heute auf das Damalige schauen, mu√ü man der Sicht der beiden Bisch√∂fe widersprechen: Gerade die gro√üen Konzilien des 4. und 5. Jahrhunderts sind Leuchtt√ľrme der Kirche geworden, die den Weg in die Mitte der Heiligen Schrift weisen und, indem sie ihre Auslegung pr√§gen, zugleich die Identit√§t des Glaubens im Wandel der Zeit kl√§ren. Aber wenn das Urteil der Geschichte im ganzen anders ausgefallen ist, aus der Entfernung nur das Gro√üe best√§ndig und umgekehrt das best√§ndig Gebliebene gro√ü erscheint, so sind die unmittelbaren Zeitgenossen offenbar doch immer wieder denselben Erfahrungen ausgesetzt gewesen, die diese Zeugen des Jahrhunderts der gro√üen Grundentscheidungen ins Wort gebracht haben. Der makroskopischen Sicht steht sozusagen die mikroskopische, die aus der N√§he, gegen√ľber, und aus der N√§he gesehen kann man nicht leugnen, da√ü fast alle Konzilien sich zun√§chst als Ersch√ľtterungen des Gleichgewichts, als Faktoren der Krise ausgewirkt haben‚Äú (Ortsbestimmung, S. 384).
Wenn wir das bedenken, dann ist die Situation nach dem II. Vatikanischen Konzil offenbar gar nicht ungew√∂hnlich, in Blick und Betrachtung der Kirchengeschichte vielmehr die neuerliche Best√§tigung einer Art historischer Gesetzm√§√üigkeit oder des geschichtlichen Normalfalls. Das zeigt uns aber auch, dass heutzutage 50 Jahre nicht unbedingt ausreichen m√ľssen, um aus der Entfernung das Gro√üe des II. Vaticanums bereits als best√§ndig und sein best√§ndig Gebliebenes schon als gro√ü erkennen zu k√∂nnen. Mehr noch, ein Abstand von nur 50 Jahren reicht wahrscheinlich meistens gar nicht aus, sicher zu wissen und mit Gewissheit zu bestimmen, was an einem Konzil √ľberhaupt best√§ndig ist und unzweifelhaft best√§ndig bleiben wird.
Piusbr√ľder als¬† ‚ÄöMonophysiten des 21. Jahrhunderts‚Äô?
Die von uns entworfene, m√∂gliche traditionalistische H√§resie eines anti-pneumatischen Monoparadosalitismus hat √ľbrigens im Monophysitismus gegen das Konzil von Chalcedon eine historische Parallele und Analogie. Diese sieht auch Ratzinger in seiner ‚ÄěOrtsbestimmung‚Äú, wenn er schreibt: ‚ÄěNicht anders ging es nach dem Konzil von Chalkedon, in dem mit der wahren Gottheit auch die wahre Menschheit Jesu ausgesagt wurde. Die Wunde, die damals entstand, hat sich bis heute nicht geschlossen: Die treuen Erben des gro√üen Bischofs Kyrill von Alexandrien f√ľhlten sich durch die Formeln verraten, die ihrer heilig gehaltenen √úberlieferung entgegenstanden; als monophysitische Christen bilden sie im Orient noch heute eine bedeutende Minorit√§t, die uns einfach durch ihr Dasein noch etwas von der H√§rte der damaligen K√§mpfe ahnen l√§√üt‚Äú¬† (ebd., S. 384f.).
Heute ist es weitgehend akzeptiert, dass die, wie Ratzinger sich ausdr√ľckt, ‚Äětreuen Erben des gro√üen Bischofs Kyrill von Alexandrien‚Äú in ihrer Christologie weitgehend missverstanden und in die Rolle von H√§retikern gedr√§ngt wurden. Es gibt freilich, wie wir aufgezeigt haben, mit den Sedisvakantisten tats√§chlich anti-pneumatische, monoparadosalitische Traditionalisten. Die treuen Erben von Erzbischof Marcel Lef√®bvre sind indes keine Monoparadosaliten. Wenn sie jetzt allerdings zu solchen abgestempelt w√ľrden, w√§re die Gefahr gro√ü, dass entsprechende, intern vorhandene Tendenzen sich als bestimmende Kr√§fte der Piusbruderschaft insgesamt bem√§chtigten oder jedenfalls die Mehrheit, die bis jetzt immer der sehr ausgewogenen Position des Generaloberen Bernard Fellay gefolgt ist, mit sich rissen.
‚Moderne’, katholische Amish People in den Katakomben
W√ľrde das eintreten, so w√ľrde die Piusbruderschaft mit den Katholiken, die schon bisher ihre Gefolgschaft gebildet haben, erneut in Katakomben und in ein, vor allem soziologisch, ¬†bedenkliches Ghetto abgedr√§ngt werden, das sie mit der Zeit wohl zu einer Art Catholic Amish People werden lassen w√ľrde. Gerade unter Konvertiten, die in der Piusbruderschaft den katholischen Glauben angenommen haben oder unter Angeh√∂rigen der Generation, die den Katholizismus praktisch nie unter normalen, gro√ükirchlichen Bedingungen kennengelernt, sondern aufgrund ihres famili√§ren Hintergrundes immer schon ausschlie√ülich in einer der typischen traditionalistischen Kapellen praktiziert haben, ist diese Tendenz l√§ngst zu beobachten, besonders stark freilich im angels√§chsischen Raum und in den politisch motivierten Teilen des traditionalistischen Spektrums in Frankreich, jedoch keineswegs absolut darauf beschr√§nkt, eben weil die Ausnahmesituation insgesamt und praktisch allerorten bereits viel zu lange andauert.
Wird sie jetzt nicht reguliert, sondern sogar zementiert, wird die psychologische Entfremdung vielleicht unumkehrbar. Man hat zurecht gesagt, dass das Pontifikat Benedikt‚Äô XVI. einen Kairos bildet, um diese Gefahr zu bannen. Dieser Kairos scheint √ľbrigens gleichfalls √ľber das Schicksal der ‚ÄěHermeneutik der Reform in Kontinuit√§t‚Äú (vgl. die Ansprache Benedikts XVI. an die R√∂mische Kurie vom 22. Dezember 2005) ¬†zu entscheiden. Bischof Fellay hat in seiner Wiener Predigt vom 20. Mai 2012 gesagt, der k√ľnftige Weg der Priesterbruderschaft St. Pius X. werde entweder ein Weg mit Rom sein oder er werde ein Weg gegen Rom werden. Beinahe 40 Jahre hat die Piusbruderschaft faktisch und praktisch einen au√üerordentlichen Weg ohne Rom beschritten. Einerseits ist jedenfalls Bernard Fellay kein Gallikaner und wei√ü daher, dass ein solcher Weg ohne Rom f√ľr einen Katholiken niemals, auch nicht durch lange Fortdauer, eine legitime Normalit√§t werden kann. Der bisherige, merkw√ľrdige Zustand der Schwebe mindestens seit 1976 kommt jetzt, so sagte es Fellay ebenfalls bei seiner gerade erw√§hnten Predigt und noch detaillierter bei einem anschlie√üenden Vortrag in Wien, an ein Ende.
Die Piusbruderschaft ist katholisch und m√∂chte es bleiben. W√§hrend aber ein vor√ľbergehender, faktischer Weg ohne Rom eventuell einmal m√∂glich und gezwungenerma√üen sogar faktisch n√∂tig sein kann und f√ľr die Bruderschaft in der Vergangenheit durch die Umst√§nde vielleicht wirklich unumg√§nglich war, ist ein prinzipieller, dauerhafter oder sogar endg√ľltiger Weg gegen Rom f√ľr den Katholiken niemals eine Option, sondern w√§re ein gegen das Katholische gerichteter Widerspruch in sich selbst. Wird jetzt andererseits den Falschen die H√§resie des anti-pneumatischen Monoparadosalitismus vorgehalten, kann sich die Situation ergeben, dass die Hermeneutik des Bruches das rechtgl√§ubige dyoparadosale Traditionskonzept in der Gesamtkirche auf lange Sicht durch eine, bestenfalls semi-pneumatistisch abgemilderte, ¬†revelationsvitalistische Vorstellung √ľberlagert. Rechtgl√§ubig w√ľrde diese Vorstellung dadurch nicht, aber sogar sehr wahrscheinlich f√ľr einige Zeit oberfl√§chlich dominant.
Ob es danach jemals wieder leicht sein w√ľrde, eine lef√®brianische Spaltung, die wir jetzt noch mit relativ geringem Einsatz vermeiden k√∂nnen, zu √ľberwinden und vor allen Dingen die Interpretation des II. Vatikanischen Konzils und des nachkonziliaren Lehramts harmonisch und konsequent in den dyoparadosalen Koh√§renzzusammenhang apostolischer und kirchlicher Tradition einzubinden, muss lebhaft bezweifelt werden. Nochmals in aller Deutlichkeit und Entschiedenheit: Die Priesterbruderschaft St. Pius X. vertritt in ihrer relevanten, offiziellen Position den skizzierten, anti-pneumatischen Monoparadosalitismus nicht und hat diesen Standpunkt auch in der Vergangenheit noch niemals eingenommen!
Vorsicht: Liturgisch sensibel ‚Äď ¬†keine Liturgiereform light mit 50 Jahren Versp√§tung, bitte!
W√ľrde dieser h√§retische, traditionalistische √úberlieferungsbegriff ¬†ihr jetzt zu Unrecht dennoch vorgeworfen, k√∂nnte sich auch f√ľr Gemeinschaften wie die Priesterbruderschaft St. Petrus und alle Gl√§ubigen, die sich f√ľr ihr liturgisches Leben auf das Motu proprio Summorum Pontificum st√ľtzen, ein Rechtfertigungsdruck ergeben oder er k√∂nnte zumindest empfunden werden, sich vom vermeintlich lef√®bvrianischen, anti-pneumatischen Monoparadosalitismus eindeutig abgrenzen zu m√ľssen, um die eigene kirchliche Loyalit√§t und rechtgl√§ubige Katholizit√§t unter Beweis zu stellen.
Mit dem Motu proprio Summorum Pontificum wurde zugleich im Begleitbrief an die Bisch√∂fe in Aussicht gestellt, das Missale Romanum von 1962 aus seiner liturgiegeschichtlich wahrlich unnat√ľrlichen Statik herauszuf√ľhren, indem es mittlerweile ¬†kanonisierte neue Heilige in seinen liturgischen Kalender und auch die eine oder andere neue Pr√§fation aufnehmen soll. Das w√§re ein v√∂llig normaler Vorgang, sogar wesentlich normaler als die jetzige, faktische Mumifizierung der √ľberlieferten Liturgie seit 1962.
Doch muss man an dieser Stelle auf die Psychologie und Sensibilit√§t des repr√§sentativen Traditionalisten hinweisen und davor warnen, dass die Kommission Ecclesia Dei oder die Gottesdienstkongregation erw√§gen oder versuchen k√∂nnte, den Ecclesia-Dei-Gemeinschaften oder anderen Priestern und Gl√§ubigen, die das Motu proprio Summorum Pontificum f√ľr sich in Anspruch nehmen, √ľber neue Heilige und Pr√§fationen hinausgehende, rituelle oder rubrizistische Reformen, die die √ľberlieferte Gestalt der r√∂mischen Liturgie n√§her an deren gegenw√§rtigen Usus ordinarius heranf√ľhren w√ľrden, verpflichtend aufzulegen.
Lumen Gentium und Sacrosanctum Concilium entfalten Theologie der Liturgie und vertiefen Eucharistielehre des Konzils von Trient
Nur wenn auf die genannte Mentalit√§t oder Befindlichkeit auch weiterhin mit Feingef√ľhl R√ľcksicht genommen wird, kann man das Ziel erreichen, dass die theologischen Leitmotive der Liturgiekonstitution des II. Vaticanums, von allen, die sich der liturgischen B√ľcher von 1962 bedienen, positiv verinnerlicht und in der konkreten Feier der Liturgie verwirklicht werden. Diese Leitmotive der Liturgiekonstitution sind dabei im Lichte der dogmatisch ausgerichteten Kirchenkonstitution Lumen Gentium zu verstehen und zu gewichten, welche lehrt: ‚ÄěSooft das Kreuzesopfer, in dem Christus, unser Osterlamm, dahingegeben wurde (1 Kor 5,7), auf dem Altar gefeiert wird, vollzieht sich das Werk unserer Erl√∂sung. Zugleich wird durch das Sakrament des eucharistischen Brotes die Einheit der Gl√§ubigen, die einen Leib in Christus bilden, dargestellt und verwirklicht (1 Kor 10,17). Alle Menschen werden zu dieser Einheit mit Christus gerufen, der das Licht der Welt ist‚Äú (LG 3).
Die eucharistietheologischen Grunds√§tze der Liturgiekonstitution finden sich insbesondere in Sacrosanctum Concilium Nrn. 5-10 und 47 und ¬†betrachten die Strukturformung der rituellen Gestalt der Eucharistie in ihrem dogmatischen Gehalt, der somit f√ľr jede eucharistische Liturgie der Kirche g√ľltig ist, als das Pascha des Neuen Bundes. Gegen√ľber dezidiert traditionsbetonten Katholiken muss man in diesem Zusammenhang herausarbeiten, dass bereits das Konzil von Trient diesen Deutungshorizont angibt (vgl. DH 1741). Da diese dogmatische Implikation in der Liturgischen Bewegung des 20. Jahrhunderts vom Benediktiner Odo Casel mit seinem Ansatz vom Pascha-Mysterium, den Vaticanum II lehramtlich rezipiert hat (vgl. SC 5), belebt und in der Theorie der Mysteriengegenwart zus√§tzlich fruchtbar zu machen versucht worden ist, begegnen viele traditionsorientierte Theologen dem Pascha-Mysterium als Schl√ľssel-Motiv von Eucharistie und Liturgie mit einer teils akzentuierten Zur√ľckhaltung.
Der Hinweis auf das Konzil von Trient, dessen Eucharistielehre Vaticanum II in LG 3 fortf√ľhrt und vertieft (vgl. LG 1), sollte eigentlich geeignet sein, diese Skepsis zu zerstreuen. Dann kann erkannt werden, dass auch die √ľberlieferte r√∂mische Liturgie ganz im Einklang mit den eucharistie- und liturgietheologischen Leitlinien der Liturgiekonstitution sowie mit der Lehre der dogmatischen Kirchenkonstitution √ľber die Eucharistie und eigentlich sogar gar nicht anders gefeiert werden kann.
Reichtum der Heiligen Schrift als Ideal in der Liturgie und als weiteres Beispiel konkreter, liturgischer Behutsamkeit
Wenn man diese liturgische R√ľcksicht nimmt und theologische Hemmschwellen gegen√ľber dem Pascha-Mysterium als letztlich unbegr√ľndet √ľberwindet, kann irgendwann eventuell auch daran gedacht werden, die √ľberlieferte Perikopenordnung der biblischen Lesungen nach dem Vorbild des Usus ordinarius durch zwei weitere Lesejahre zu erg√§nzen und so dem Desiderat der Liturgiekonstitution zu entsprechen, den ‚ÄěTisch des Gotteswortes‚Äú reicher zu decken (vgl. SC 35,1 und 51). Wegen der engen Verwobenheit der klassischen Leseordnung des Usus antiquior mit den sonstigen Elementen seiner Messformulare und des Breviergebetes w√§re diese Aufgabe allerdings eine liturgisch anspruchsvolle Herausforderung und sollten die beiden zus√§tzlichen Lesejahre auf alle F√§lle stets fakultativ bleiben; die bestehende Perikopenordnung weiterhin jederzeit verwendet werden d√ľrfen. Etwa die klassische Perikopenordnung kurzerhand als ‚Äětridentinisches Lesejahr A‚Äú zu deklarieren und ansonsten einfach die Lesejahre B und C des Usus ordinarius zu √ľbernehmen, w√§re liturgisch ‚Äď nicht zuletzt wegen der kalendarischen Unterschiede ‚Äď in keinem Fall sinnvoll.
W√ľrde man seitens der Kommission Ecclesia Dei oder der Gottesdienstkongregation die gerade angemahnte R√ľcksichtnahme und Sensibilit√§t vermissenlassen ¬†– ¬†und nur deshalb wurde das Thema Liturgie hier eigentlich √ľberhaupt angeschnitten ‚Äď w√ľrde man zweifelsohne nahezu alle Priester und Gl√§ubigen, die den Usus extraordinarius nicht nur aus Nostalgie oder oberfl√§chlichem √Ąsthetizismus pflegen, sondern theologische √úberzeugungen und spirituelle Verankerungen damit verbinden, in die Arme echter Monoparadosaliten¬† treiben und so auch manchen, jetzt noch nur latenten, tendenzi√∂sen anti-pneumatischen Monoparadosalitismus zur Ausdr√ľcklichkeit entschiedener h√§retischer √úberzeugung versch√§rfen.
Foto: Petersdom – Bildquelle: Radomil, CC