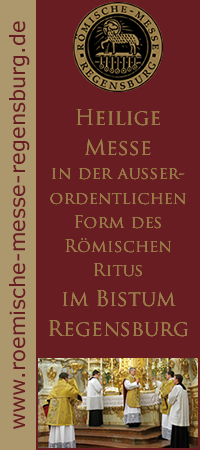Kardinal Müller übt scharfe Kritik an römischer Synode über Synodalität

Rom (kathnews/EWTN). Aufsehen hat ein Interview erregt, das der frühere Präfekt der Kongregation (nunmehr: Dikasterium) für die Glaubenslehre kürzlich im US-amerikanischen Fernsehen gegeben hat und das vom katholischen Sender EWTN ausgestrahlt wurde. Gleichermaßen interessant und ironisch mutet es an, dass die Formulierungen des deutschen Kurienkardinals frappierend an traditionalistische Kritik am Zweiten Vatikanischen Konzil erinnern.
So spricht Müller davon, eine „feindliche Übernahme der Kirche“ sei geplant. Der Kardinal diagnostiziert ein Wiedererstarken der „Häresie des Modernismus“. Von dieser gibt er eine treffende Definition: Der Modernismus setze individuelle Erfahrung mit der objektiven Offenbarung Gottes gleich, in die eigene Vorstellungen projiziert würden. Der Generalsekretär der Synodalitätssynode, Kardinal Mario Grech, verwechsle die Lehre der Kirche mit dem Programm einer politischen Partei, das jeweils auf die Präferenzen der Wähler abgestimmt und geändert werden könne.
Die Ausführungen Kardinal Gerhard Ludwig Müllers verdeutlichen, dass es nicht lösungsorientiert ist, zwischen einem authentischen Verständnis von Synodalität, das Papst Franziskus vertrete, und einem Zerrbild davon, das in den Zielsetzungen des deutschen Synodalen Weges gegeben sei, eine nennenswerte Differenz ausmachen zu wollen. Kardinal Müller muss sich die Frage stellen, ob nicht doch bereits im Zweiten Vaticanum selbst Ansätze und eine Dynamik vorliegen, die mit einer gewissen Logik und Folgerichtigkeit sich jetzt unter dem Decknamen der Synodalität volle Durchsetzung verschaffen.
Die Instrumentalisierung des Wirkens des Heiligen Geistes, die Kardinal Müller im Synodenprozess kritisiert, hat offensichtlich ihre Grundlage in einem inhaltlich vitalen Traditionsbegriff und Offenbarungsverständnis, die sich tatsächlich auf das Konzil zurückführen lassen. Ein Traditionsbegriff, der jedenfalls für das gesamte nachkonziliare Lehramt kennzeichnend gewesen ist, nicht erst für das gegenwärtige Pontifikat. Allerdings sagte Papst Franziskus in seiner Predigt zum 60. Jahrestag der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils am vergangenen 11. Oktober nicht umsonst: „Kehren wir zum Konzil zurück, das den lebendigen Fluss der Tradition wiederentdeckt hat [kursiv zur Hervorhebung, C. V. O.], statt in Traditionen zu erstarren; das die Quelle der Liebe wiederentdeckt hat, nicht um auf dem Berg zu bleiben, sondern damit die Kirche ins Tal hinabsteige und ein Kanal der Barmherzigkeit für alle werde.“
Es wäre aufschlussreich, den Papst zu fragen, wann denn die Kirche seiner Meinung nach das verloren hat, was das Zweite Vaticanum sie wiederentdecken ließ: ein zutreffendes Verständnis von Tradition und – mehr noch – den Quell der Liebe. Wenn man diese Behauptung recht bedenkt, schließt sie eine ungeheuerliche Anschuldigung des Papstes an die Kirche bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil in sich.
Foto: Kardinal Müller – Bildquelle: M. Bürger, kathnews.de