Heilige Schrift und Glaube der Kirche
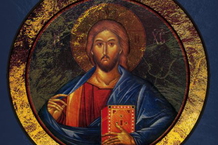
Es folgen die Texte des Katechismus der Katholischen Kirche zu den Lesungen des dritten Ostersonntages in der sog. ordentlichen Form des Römischen Ritus (Zusammenstellung: Gero P. Weishaupt. Quelle: Homiletisches Direktorium der Kongregation fĂŒr den Gottesdienst und die Sakramentenordnung).
Aus der heiligen Schrift
Apg 5, 27b-32.40b-41
Zeugen der Ereignisse sind wir und der Heilige Geist
Offb 5, 11-14
WĂŒrdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde, Macht zu empfangen und Herrlichkeit
Joh 21, 1-19
Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch.
Aus dem Katechismus der Katholischen Kirche
Die Apostel und JĂŒnger als Zeugen der Auferstehung
642 Alles, was in diesen Ostertagen geschah, stellte die Apostel – und ganz besonders Petrus – in den Dienst am Aufbau der neuen Ăra, die am Ostermorgen anbrach. Als Zeugen des Auferstandenen bleiben sie die Grundsteine seiner Kirche. Der Glaube der ersten Glaubensgemeinde grĂŒndet auf dem Zeugnis konkreter Menschen, die den Christen bekannt waren und von denen die meisten noch unter ihnen lebten. Diese âZeugen der Auferstehung“ Christi [Vgl. Apg 1,22.] sind vor allem Petrus und die Zwölf, aber nicht nur sie: Paulus spricht klar von mehr als fĂŒnfhundert Personen, denen Jesus gleichzeitig erschienen ist; er erschien auch dem Jakobus und allen Aposteln [Vgl. 1 Kor 15,4-8.].
643 Angesichts dieser Zeugnisse ist es unmöglich, die Auferstehung als etwas zu interpretieren, das nicht der physischen Ordnung angehört, und sie nicht als ein geschichtliches Faktum anzuerkennen. Aus den Ereignissen ergibt sich, daĂ der Glaube der JĂŒnger die ĂŒberaus harte PrĂŒfung des Leidens und des Kreuzestodes ihres Meisters durchmachen muĂte, die dieser vorausgesagt hatte [Vgl. Lk 22,31-32.]. Die JĂŒnger (jedenfalls einige von ihnen) waren durch die Passion so sehr erschĂŒttert worden, daĂ sie der Kunde von der Auferstehung nicht ohne weiteres Glauben schenkten. Die Evangelien zeigen uns keineswegs eine mystisch hingerissene Gemeinde, sondern JĂŒnger, die niedergeschlagen (,âtrĂŒbe dreinblickend“: Lk 24,17) und erschrocken [Vgl. Job 20,19.] waren. Darum schenkten sie den heiligen Frauen, die vom Grabe zurĂŒckkehrten, keinen Glauben und âhielten das alles fĂŒr GeschwĂ€tz“ (Lk 24, 11) [Vgl. Mk 16,11.13.]. Als Jesus sich am Osterabend den Elfen zeigte, âtadelte er ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten“ (Mk 16,14).
644 Sogar angesichts des auferstandenen Jesus selbst zweifeln die JĂŒnger noch [Vgl. Lk 24,38.], da ihnen die Sache so unmöglich erscheint: Sie meinen, ein Gespenst zu sehen [Vgl. Lk 24,39.].,,Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben“ (Lk 24,41). Thomas wird die gleiche PrĂŒfung des Zweifels durchmachen [Vgl. Job 20,24-27.], und noch bei der letzten Erscheinung in GalilĂ€a, von der MatthĂ€us berichtet, hatten einige âZweifel“ (Mt 28,17). Darum lĂ€Ăt sich die Hypothese, daĂ die Auferstehung ein âErzeugnis“ des Glaubens (oder der LeichtglĂ€ubigkeit) der Apostel gewesen sei, nicht halten. Ganz im Gegenteil, ihr Glaube an die Auferstehung – unter dem Wirken der göttlichen Gnade – ist aus der unmittelbaren Erfahrung der Wirklichkeit des auferstandenen Christus selbst hervorgegangen.
857 Die Kirche ist apostolisch, weil sie auf die Apostel gegrĂŒndet ist und zwar in einem dreifachen Sinn:
– sie ist und bleibt âauf das Fundament der Apostel“ gebaut (Eph 2, 20) [Vgl. Offb 21,14], auf die von Christus selbst erwĂ€hlten und ausgesandten Zeugen [Vgl. z.B. Mt 28,16-20; Apg 1,8; 1 Kor 9.1; 15,7-8; Gal 1,1];
– sie bewahrt mit dem Beistand des in ihr wohnenden Geistes die Lehre [Vgl. Apg 2,42], das GlaubensvermĂ€chtnis sowie die gesunden GrundsĂ€tze der Apostel und gibt sie weiter [Vgl. 2Tim 1.13-14,];
– sie wird bis zur Wiederkunft Christi weiterhin von den Aposteln belehrt, geheiligt und geleitet – und zwar durch jene, die ihnen in ihrem Hirtenamt nachfolgen: das Bischofskollegium, âdem die Priester zur Seite stehen, in Einheit mit dem Nachfolger des Petrus, dem obersten Hirten der Kirche“ (AG 5).
âDu bist der ewige Hirt, der seine Herde nicht verlĂ€Ăt; du hĂŒtest sie allezeit durch deine heiligen Apostel. Du hast sie der Kirche als Hirten gegeben, damit sie ihr vorstehen als Stellvertreter deines Sohnes“ (MR, PrĂ€fation von den Aposteln).
995 Zeuge Christi sein heiĂt âZeuge seiner Auferstehung sein“ (Apg 1,22) [Vgl. Apg 4,33], âmit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben“ (Apg 10,41). Die christliche Auferstehungshoffnung ist ganz durch die Begegnungen mit dem auferstandenen Christus geprĂ€gt. Wir werden gleich ihm, mit ihm und durch ihn auferstehen.
996 Der christliche Auferstehungsglaube ist von Anfang an auf UnverstĂ€ndnis und Widerstand gestoĂen [Vgl. Apg 17,32; 1 Kor 15,12-13]. âDer christliche Glaube stöĂt in keinem Punkt auf mehr Widerspruch als in bezug auf die Auferstehung des Fleisches“ (Augustinus, Psal. 88,2,5). Man nimmt allgemein an, daĂ das Leben der menschlichen Person nach dem Tod geistig weitergeht. Wie kann man aber glauben, daĂ dieser so offensichtlich sterbliche Leib zum ewigen Leben auferstehen wird?
Der auferstandene Christus und Petrus
553 Jesus hat Petrus eine besondere AutoritĂ€t anvertraut: ,,Ich werde dir die SchlĂŒssel des Himmelreichs geben; was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein“ (Mt 16,19). Die ,,SchlĂŒsselgewalt“ bedeutet die Vollmacht, das Haus Gottes, die Kirche, zu leiten. Jesus, ,,der gute Hirt“ (Joh 10,11), hat diesen Auftrag nach seiner Auferstehung bestĂ€tigt: ,,Weide meine Schafe !,, (Joh 21,15-17). Die Gewalt, zu ,,binden“ und zu ,,lösen“, besagt die Vollmacht, in der Kirche von SĂŒnden loszusprechen, Lehrurteile zu fĂ€llen und disziplinarische Entscheide zu treffen. Jesus hat der Kirche diese AutoritĂ€t durch den Dienst der Apostel [Vgl. Mt 18,18.] und insbesondere des Petrus anvertraut, dem er als einzigem die SchlĂŒssel des Reiches ausdrĂŒcklich ĂŒbergeben hat.
641 Die Ersten, die dem Auferstandenen begegneten [Vgl. Mt 28,9-10; Joh 20, 11-18.], waren Maria von Magdala und die heiligen Frauen, die zum Grabe kamen, um den Leichnam Jesu einzubalsamieren [Vgl. Mk 16,1; Lk 24,1.], der am Karfreitagabend, weil der Sabbat anbrach, hastig bestattet worden war [Vgl. Job 19, 31.42.]. So waren Frauen selbst fĂŒr die Apostel [Vgl. Lk 24, 9-10.] die ersten Botinnen der Auferstehung Christi. Danach erschien Jesus den Aposteln, zuerst dem Petrus, dann den Zwölfen [Vgl. 1 Kor 15,5.]. Petrus, der den Auftrag erhalten hat, den Glauben seiner BrĂŒder zu stĂ€rken [Vgl. Lk 22,31-32.], erblickt also den Auferstandenen vor diesen, und auf sein Zeugnis hin ruft die Gemeinschaft aus: âDer Herr ist wirkich auferstanden und ist dem Simon erschienen“ (Lk 24,34).
881 Der Herr hat einzig Simon, dem er den Namen Petrus gab, zum Felsen seiner Kirche gemacht. Er hat Petrus die SchlĂŒssel der Kirche ĂŒbergebenâ und ihn zum Hirten der ganzen Herde bestellt [Vgl. Joli 21,15-17]. âEs steht aber fest, daĂ jenes Amt des Bindens und Lösens, das Petrus gegeben wurde, auch dem mit seinem Haupt verbundenen Apostelkollegium zugeteilt worden ist“ (LG 22). Dieses Hirtenamt des Petrus und der anderen Apostel gehört zu den Grundlagen der Kirche. Es wird unter dem Primat des Papstes von den Bischöfen weitergefĂŒhrt.
1429 Davon zeugt die Bekehrung des Petrus nach der dreifachen Verleugnung seines Meisters. Der erbarmungsvolle Blick Jesu ruft TrĂ€nen der Reue hervor [Vgl. 1 Joh 4,10] und nach der Auferstehung des Herrn das dreifache Ja des Petrus auf die Frage Jesu, ob er ihn liebe [Vgl. Joh 21,15-17]. Die zweite Umkehr weist auch eine gemeinschaftliche Dimension auf. Diese zeigt sich in der durch Jesus an eine ganze Kirche gerichteten Aufforderung: âKehr um!“ (Offb 2,5.16).
Der hl. Ambrosius sagt von den zwei Arten der Umkehr, in der Kirche gebe es âdas Wasser und die TrĂ€nen: das Wasser der Taufe und die TrĂ€nen der BuĂe“(ep. 41,12).
Die himmlische Liturgie
1090 âIn der irdischen Liturgie nehmen wir vorauskostend an jener himmlischen teil, die in der heiligen Stadt Jerusalem, zu der wir pilgernd unterwegs sind, gefeiert wird, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt, der Diener des Heiligtums und des wahren Zeltes; [in der irdischen Liturgie] singen wir dem Herrn mit der ganzen Schar des himmlischen Heeres den Lobgesang der Herrlichkeit; [in ihr] verehren wir das GedĂ€chtnis der Heiligen und erhoffen eine Teilhabe und Gemeinschaft mit ihnen; [in ihr] erwarten wir den Erlöser, unseren Herrn Jesus Christus, bis er, unser Leben, selbst erscheinen wird und wir mit ihm erscheinen werden in Herrlichkeit“ (SC 8) [ 1 Vgl. LG 50].
1137 Die Apokalypse des hl. Johannes, die in der Liturgie der Kirche gelesen wird, offenbart zunĂ€chst: âEin Thron stand im Himmel; auf dem Thron saĂ einer“ (Offb 4,2): Gott âder Herr“ (Jes 6,1)[Vgl. Ez 1,26-28]. Sodann sieht der hi. Johannes das Lamm, das aussah âwie geschlachtet“ (Offb 5,6) [Vgl. Joh 1,29]: es ist der gekreuzigte und auferweckte Christus, der einzige Hohepriester des wahren Heiligtums [Vgl. z.B. Hebr 4,14-15; 10. 19-21], der zugleich âopfert und geopfert wird, darbringt und dargebracht wird“ (Liturgie des hl. Johannes Chrysostomus, Hochgebet). SchlieĂlich zeigt sich âein Strom, Wasser des Lebens … er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus“ (Offb 22,1) – eines der schönsten Sinnbilder fĂŒr den Heiligen Geist [Vgl. Joh 4,10-14. Offb 21,6].
1138 Am Dienst des Lobpreises Gottes und an der Verwirklichung seines Planes sind alle beteiligt, die unter Christus, dem Haupt, erneut zusammengefaĂt sind: die himmlischen MĂ€chte [Vgl. Offb 4-5: Jes 6.2-3], die ganze Schöpfung (in der Offenbarung dargestellt durch die vier Lebewesen), die Diener des Alten und des Neuen Bundes (die vierundzwanzig Ăltesten), das neue Volk Gottes (die Hundertvierundvierzigtausend [Vgl. Offb 7,1-8; 14,1]), insbesondere die fĂŒr das Wort Gottes hingeschlachteten Blutzeugen [Vgl. Offb 6,9-11] und die heilige Gottesmutter (die Frau [Vgl. Offb 12], die Braut des Lammes [Vgl. Offb 21,9]), und schlieĂlich âeine groĂe Schar aus allen Nationen und StĂ€mmen, Völkern und Sprachen; niemand konnte sie zĂ€hlen“ (Offb 7,9).
1139 An dieser ewigen Liturgie lassen uns der Geist und die Kirche teilnehmen, wenn wir in den Sakramenten das Heilsmysterium feiern.
1326 Durch die Eucharistiefeier vereinen wir uns schon jetzt mit der Liturgie des Himmels und nehmen das ewige Leben vorweg, in dem Gott alles in allen sein wird [Vgl. 1 Kor 15,28].
Foto: Jesus der König – Bildquelle: Sarto-Verlag










