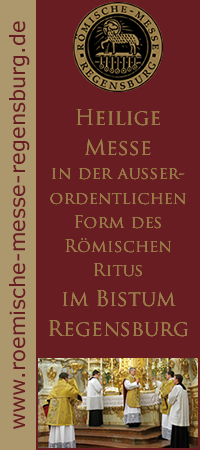Der Gehorsam Petri und seiner Nachfolger – oder der Mangel daran

Staunenswert ist die Produktivität, mit der der amerikanische Theologe Peter Kwasniewski beinahe täglich auf Internetseiten wie New Liturgical Movement, One Peter Fife oder LifeSite News meist sogar recht tiefschürfende, ausführliche Beiträge zu vorwiegend theologischen, liturgischen und kirchenmusikalischen Themen veröffentlicht. Gleichzeitig entfaltet er eine ebenso beeindruckende Vortrags- und Reisetätigkeit, die nicht nur die englischsprachige Welt erreicht, sondern ihn immer wieder auch in den deutschen Sprachraum führt, mit dem er vertraut ist, da er ab 1998 acht Jahre in Österreich gelebt und am seinerzeit in der ehemaligen Karthause Gaming ansässigen Internationalen Theologischen Institut für Studien zu Ehe und Familie gewirkt hat. Also von einer ursprünglich mehr neokonservativen Haltung geprägt und diese vertretend, hat Kwasniewski sich mindestens während des gesamten vergangenen Jahrzehnts zunehmend mit Fragen der traditionellen Liturgie beschäftigt und über diese Vermittlung verstärkt mit der normativen Kraft auseinandergesetzt, welche die Tradition grundsätzlich für die Theologie und Kirche besitzt.
Seine immer deutlicher und schärfer werdende Wahrnehmung eines zuerst ausgehöhlten Traditionsbegriffs, dann, und besonders ostentativ im aktuellen Pontifikat, einer ganz offen angegriffenen und unterdrückten Tradition selbst macht Kwasniewski in verunsicherten oder bereits längst liturgisch und theologisch ohnehin traditionsorientierten kirchlichen Kreisen zu einem begehrten Redner und Autor. Letzteres gilt namentlich für Personen, die ihrerseits durch das vorangegangene Pontifikat Benedikts XVI., das sie als traditionsfreundlich und –förderlich empfanden, ein Gespür für Größen wie Überlieferung und Kontinuität entwickelt und insbesondere eine ästhetisch hochstehend und ideal gefeierte vorkonziliare Liturgie für sich entdeckt hatten, welche nun durch den unmittelbaren, offensichtlichen Kontrast und Widerspruch von Papst Franziskus – vor allem seit der radikalen Rücknahme von Summorum Pontificum und der Geltung von Traditionis Custodes – zutiefst erschüttert sind.
Dass bei ihnen eine solche Erschütterung und Verunsicherung besteht, ist freilich auf eine oftmals unzureichende Kenntnis der systematischen Unterdrückung der überlieferten Liturgie in den direkt auf die nachkonziliare sogenannte Liturgiereform Pauls VI. und deren Umsetzung folgenden Jahren von 1969 bis 1984 zurückzuführen, wie auch darauf, dass die gutgemeinte eigene Verankerung in der Tradition oftmals mehr gefühlsbetont war, statt auf einem soliden Fundament gut gefestigt und begründet zu sein. Dies soll hier nicht als eine Kritik an der subjektiven Redlichkeit von Katholiken verstanden werden, die sich unter dem positiv aufgenommenen Einfluss Ratzingers beziehungsweise Papst Benedikts der Alten Messe zugewandt hatten oder auch erst jetzt zu ihr flüchten und gerade deshalb von Papst Franziskus verfolgt werden; sich wenigstens so fühlen. Diese Gläubigen aufzufangen und zu konsolidieren, ist darum ein wertvolles geistliches Werk der Barmherzigkeit, das Peter Kwasniewski mit seinen Artikeln, Vorträgen und Büchern leistet.
Antwort auf den Schock nach Traditionis Custodes
Schon im Klima und noch im ersten Schock, die mit Traditionis Custodes einsetzten, widmete Kwasniewski dem Thema und der Problematik rechtverstandenen kirchlichen Gehorsams einen Anfang Oktober 2021 auf der Catholic Identity Conference in Pittsburgh gehaltenen Redebeitrag, der im Sommer 2022 auch in einer von Kwasniewski autorisierten, jedoch nicht selbst erstellten deutschen Fassung als kleines Büchlein erschienen ist. Der eigentliche Text umfasst nur 69, ein Apparat von insgesamt 96 Endnoten weitere 30 Seiten.
Um die Auseinandersetzung mit dieser Kleinschrift mit meiner Rezension derselben nicht vollständig vorwegzunehmen und letztlich überflüssig zu machen, wird im folgenden kein lückenloser Überblick oder gar eine erschöpfende Inhaltsangabe geboten. Stattdessen sollen ausgewählte Zitate und thematische Details herausgegriffen und kommentiert werden, die wie neuralgische Punkte den Konflikt, vor den man sich gestellt sehen kann, verdeutlichen. Sehr treffend charakterisiert Kwasniewski die grundlegende Problematik: „In den 60er-, 70er und 80er-Jahren war das ,Gewissen‘ die Domäne der Progressiven, die versuchten, von der immerwährenden Lehre […] abzuweichen. […] Für sie ist ;Gewissen‘ offenbar gleichbedeutend mit ,meine Wünsche als autonomer moderner Mensch, der sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft oder unterwerfen will‘. Diese politisierte Verfälschung führte zu einer gegenteiligen Reaktion unter Konservativen und Anhängern der Tradition, die das Wort ebenfalls missbrauchten [hier würde die Übersetzung vielleicht besser missverstanden lauten; zur generellen Qualität und zu bestimmten Mängeln der deutschen Übersetzung später mehr, Anm. C. V. O.], indem sie ein ,gut ausgebildetes Gewissen‘ mit ,automatischer Unterwerfung unter eine äußere Autorität‘ gleichsetzten, was […] darauf hinauslief, dass der Wille des Papstes zum einzigen und notwendigen Handlungsprinzip für tugendhafte Katholiken erklärt wurde“ (S. 44).“
An dieser Stelle benennt Kwasniewski anschaulich den Zusammenhang und möglichen Konflikt von Gehorsam und Gewissen und auch die für Konservative nach dem Zweiten Vaticanum typische Betonung eines formalen Gehorsams, gern in einer starken Konzentration auf dessen Person als Treue zum Papst oder Papsttreue bezeichnet, was solange gutging, wie der Amtsinhaber konservativ war oder zumindest in als wesentlich betrachteten Bereichen als konservativ galt, was wiederum etwa dann der Fall war und selbst unter Franziskus noch punktuell der Fall ist, sobald der Papst in der gesellschaftlichen wie kirchlichen Öffentlichkeit oder in den Medien mit seinen Positionen auf Ablehnung stößt. Weil in dem zitierten Passus indes gerade die Zeitspanne der 1960er bis 1980er Jahre in den Blick genommen wird, ist allerdings zu fragen, ob die Anhänger der Tradition in diesem Kontext zu Recht mit angeführt werden. Denn hätten die originalen Traditionalisten nach dem Konzil tatsächlich einen solch papalistischen Gehorsamsbegriff vertreten, hätte es von ihrer Seite gar keinen gleich einsetzenden Widerstand gegen die Liturgiereform geben können, und ohne dass es ein scheinbar ungehorsames Festhalten an der Alten Messe von Anfang an gegeben hätte, wäre es wohl auch überhaupt nie zu einem gesamtkirchlich anwendbaren ersten Indult von 1984 gekommen.
Summorum Pontificum wurde häufig überschätzt oder überbewertet
Was die rechtliche Situation anbelangt, die dann 2007 Papst Benedikt XVI. schuf, zitiert Kwasniewski offenbar voll zustimmend Martin Mosebach, denn dessen Einschätzung nennt er „messerscharf“: „Benedikt hat nämlich die ;Alte Messe‘ nicht ,erlaubt‘, er hat kein Privileg gewährt, sie zu zelebrieren, er hat kurzum keine disziplinarische Maßnahme getroffen, die ein Nachfolger wieder zurücknehmen könnte. Das Neue und Überraschende seines Gesetzgebungsaktes war vielmehr, dass die Zelebration der alten Messe keiner Genehmigung bedürfe. Sie sei niemals verboten gewesen – weil sie gar nicht verboten werden könne. Hier, so darf man schließen, liegt eine unüberwindliche Grenze für die Vollmacht eines Papstes. Die Tradition steht über dem Papst, besonders die tief im ersten christlichen Jahrtausend wurzelnde alte Messe ist der Verbotsgewalt eines Papstes grundsätzlich entzogen“ (S.34). Ob diese Einschätzung wirklich so messerscharf ist, ist fraglich, denn in der Schlussfolgerung mischen sich bei Mosebach die tatsächliche Konklusion aus der von Benedikt XVI. getroffenen Regelung mit einer gewiss zutreffenden Annahme bezüglich einer wenigstens 1500 Jahre alten überlieferungsgesättigten liturgischen Praxis und schließlich mit Mosebachs eigener Präferenz oder erwünschten Deutung und Auslegung von Ratzingers vermeintlicher Position.
Immerhin betraf doch die voraussetzungslose Freigabe der Feier der Messe nach dem Missale Romanum von 1962 gemäß Art. 2 SP lediglich die private Zelebration, zu der gewöhnlich außer dem Ministranten zwar Gläubige zugelassen werden können, aber nicht müssen (außerdem könnte der Bischof einem Priester durchaus legitim und rechtlich bindend diesbezüglich eine zusätzliche Beschränkung auferlegen) und ansonsten gemäß Art. 9 § 3 zusätzlich bloß noch die frei zu wählende Möglichkeit, die Verpflichtung zum Stundengebet anhand des Breviarium Romanum von 1962 zu erfüllen, was ohnehin meist rein privat geschieht, also für gewöhnlich in einem Rahmen, in dem keine Gläubigen anwesend, jedenfalls nicht beteiligt sind.
Die Tradition selbst ermächtigt uns zum Festhalten an ihr und gebietet Treue
Da ist Kwasniewskis eigenes Verständnis der Bulle Quo Primum schon viel überzeugender: „Papst [Pius V., Anm. C. V. O.] hat nicht bewirkt, dass die Messe [hier wäre wohl besser und präziser vom römisch-gregorianischen Messritus die Rede, den Pius V. im Gefolge des Tridentinums kodifiziert hat, Anm. C. V. O.] durch die Veröffentlichung von Quo Primum unantastbar wurde, sondern Quo Primum wurde durch die Messe unantastbar. Diese Apostolische Konstitution konnte nur als [wohl eher: zur, Anm. C. V. O.] angemessene[n] Aufrechterhaltung einer bestehenden, bereits unantastbaren traditionellen Messe promulgiert werden und kann auch nur so verstanden werden. Daher bleibt das Zeugnis von Quo Primum für die immerwährende lex orandi und lex credendi der Kirche von Rom in Kraft und garantiert das immerwährende Recht der tridentinischen Messe sowie das Recht des lateinischen Klerus, sie zu feiern“ (S. 36f). Dieser Punkt sollte vertieft und in zwei Hinsichten deutlicher herausgearbeitet werden. Die Traditionalisten der ersten Stunde hielten ganz überwiegend instinktiv an der überlieferten Liturgie fest und wollten sie nicht aufgeben.
In diesem Zusammenhang ist zu verweisen auf das, was Kwasniewski zum Sensus fidelium ausführt (vgl. S. 40-44). Gleichzeitig stimmt es freilich bedenklich, dass diese bleibende Verbundenheit mit der überlieferten Liturgie zwar überall in der Kirche unter Priestern und Gläubigen vorkam, dabei aber von Anfang an kein Massenphänomen war. Die meisten nahmen den Ritus Pauls VI. an oder hin oder waren ihm gegenüber ebenso gleichgültig wie zuvor gegenüber dem tridentinischen Messritus.
Kodifikation versus Neuschöfpfung und wo verläuft die Grenze?
Die zweite Hinsicht, unter der das Argument geschärft werden muss, wäre sodann der Unterschied, der zwischen der nachtridentinischen Liturgiereform durch Pius V. und jener nach dem Zweiten Vaticanum durch Paul VI. besteht. Ersterer ließ den bestehenden Ritus Roms unter Beiziehung der besten erreichbaren Manuskripte sichten und behutsam redigieren und kodifizierte diesen im wesentlichen vorher längst geübten Ritus im ersten Missale Romanum von 1570, Papa Montini ließ einen im wesentlichen neuen Ritus ausarbeiten, den es vorher nicht gegeben hatte, definierte ihn positivistisch als römisch, weswegen das nachkonziliare Messbuch von 1969/70 den alten Namen Missale Romanum rein formal betrachtet denn auch beibehalten konnte und mochte. Hier kann und sollte man auch noch einräumen, dass dieser störende Unterschied in beiden Reformvorgängen nicht sogleich umfassend und mit voller Wucht eingetreten war. Konkret kann man gewiss sagen, dass der neue Messordo, den die Ritenkongregation am 27. Januar 1965 veröffentlichte, das berechtigte Anliegen der tatsächlich intendierten konziliaren Liturgiereform erfüllte und zugleich in den Grenzen einer neuerlichen Kodifikation des römisch-gregorianischen Ritus verblieb, die, wie erstmals nach Trient, jetzt auch wieder im Anschluss an das Zweite Vaticanum hätte erfolgen können, ohne durch Quo Primum prinzipiell unterbunden oder ausgeschlossen zu sein.
Damit soll von mir als Rezensenten nicht gesagt sein, dass alles an diesem noch akzeptablen Reformschritt des Ordo von 1965 glücklich gewesen sei. Ich stimme sogar mit Kwasniewski überein, dass partiell, dafür allerdings bezogen auf das liturgische Herzstück des ganzen Kirchenjahres, die rituellen Änderungen in der Karwoche 1955 bereits keine Kodifizierung, sondern schon einen Verstoß gegen Quo Primum darstellten: „Deshalb steht die Aufnahme der neuen Karwoche von Pius XII. in die editio typica des Missale Romanum von 1962 im Widerspruch zu dessen vorangestellten [Dokument, Anm. C. V. O.] Quo Primum. […] Anhänger der Tradition, die mit ihren Grundsätzen übereinstimmen wollen [eine gelungenere oder die beabsichtigte Aussage Kwasniewskis besser treffende deutsche Formulierung würde hier wohl eher lauten: Anhänger der Tradition, die in sich konsistente Prinzipien vertreten wollen, Anm. C. V. O.], müssen die Karwoche vor dem Jahr [19]55 verwenden, für die keine Genehmigung erforderlich ist“ (Endnote 52, S. 84f, hier wird aus deren 3. Absatz, S. 85, zitiert).
Wer Peter Kwasniewskis in Buchform unter dem Titel Wahrer Gehorsam in der Kirche. Ein Leitfaden in schwerer Zeit erschienenen Vortrag über das Gehorsamsproblem auf sich wirken lässt, wird sich vielfach an Wolfgang Waldsteins Dokumentation aus dem Jahre 1977 erinnert fühlen, die damals als Hirtensorge und Liturgiereform publiziert wurde und sich für den Fortbestand der überlieferten Liturgie jedenfalls als Möglichkeit für jene, die sie beibehalten wollten, einsetzte – übrigens unter Akzeptanz und Einbezug des Reformschrittes von 1965. Waldstein zitiert darin den Liturgiewissenschaftler Klaus Gamber (1919-1989): „Während die genannte Revision des Jahres 1965 den traditionellen Ritus unangetastet ließ und gemäß Artikel 50 der Liturgiekonstitution vor allem einige spätere Einfügungen in den Meßordo beseitigte, hat man durch den ‚Ordo missae‘ von 1969 einen neuen Ritus geschaffen. Dadurch wurde der bisherige nicht im Sinne des Konzils revidiert, sondern gänzlich abgeschafft und einige Jahre später sogar ausdrücklich verboten“ (zitiert in: Waldstein, W., Hirtensorge und Liturgiereform. Eine Dokumentation, Schaan 1977, S. 91).
Der Flaschengeist der 1970er ist wieder losgelassen
Das Buch Kwasniewskis und jenes von Waldstein ergänzen einander hervorragend, weil wir eben leider infolge von Traditionis Custodes formalrechtlich in die damalige Situation zurückkatapultiert werden sollen. Das muss zu der Einsicht führen, dass eine rein formalrechtliche Herangehensweise als Begründung oder gar Rechtfertigung eines Beharrens auf der Tradition und ihrer historisch gereiften und lebendig bewahrten Gestalt nicht weiterhilft und dass insofern die Inanspruchnahme jedes Indultes, einschließlich auch der umfassend scheinenden Freigabe durch Summorum Pontificum, für das Anliegen letztlich kontraproduktiv und daher verfehlt war. Die Tradition selbst ermächtigt uns zur Genüge, an ihr festzuhalten und verpflichtet zugleich dazu, sobald man einmal zur Einsicht ihrer normativen Kraft gelangt ist.
Jene aber, die bisher ängstlich meinten, eine Erlaubnis einholen zu müssen, haben jetzt sicher Schwierigkeiten, gegen Traditionis Custodes zu argumentieren. Ihnen wird es auch schwerfallen, außerhalb offizieller Strukturen auszuharren und wie Ausgeschlossene, um nicht zu sagen: wie Aussätzige, zu erscheinen. Das betrifft auch die Petrusbrüder, denn das Privileg, das sie von Papst Franziskus erhalten haben, bezieht sich eindeutig nur auf eigene (kanonisch errichtete) Häuser und die zugehörigen Kirchen und Kapellen, nicht auf all die Gotteshäuser, wo sie bisher lediglich Gäste sind.
Aus Traditionstreue nicht in das entgegengesetzte Extrem verfallen
In einem letzten, inhaltlichen Wort möchte ich noch einen Perspektivwechsel vornehmen: Auch wenn mit der Missalereform von 1969 der Rahmen einer legitimen Kodifikation anfänglich gesprengt worden sein mag, muss man nach über fünfzig Jahren der Anwendung mit der Möglichkeit rechnen, dass dem Missale Pauls VI. dort, wo man sich verpflichtet sah und sieht, es anzunehmen und sich bemüht hat, es im Geiste einer gewachsenen Liturgie zu verwenden, eine gewisse Berechtigung und Legitimität zugewachsen ist, so dass es nicht gerecht wäre, jedem, der es und die anderen aktuellen liturgischen Bücher in diesem Sinne gebraucht, die Katholizität abzusprechen oder zu behaupten, die von Paul VI. reformierte und seither von allen Päpsten ausschließlich benutzte Liturgie führe, wenn auch schrittweise und auf Dauer, letztendlich in jedem Falle und zwangsläufig zum Verlust des katholischen Glaubens. Diese Ansicht vertreten ja jedenfalls manche Radikaltraditionalisten, deren Sichtweise wohl auch durch einen gewissen Realitätsverlust gekennzeichnet ist, so als könne die paulinisch-nachvatikanische Liturgie überhaupt noch von heute auf morgen wieder völlig verboten und spurlos beseitigt werden.
Kleine Mängel der deutschen Ausgabe von Kwasniewskis Buch
Der Lesegenuss von Wahrer Gehorsam in der Kirche wird durch verschiedene, bedauerliche Details gestört. Der Gebrauch und Einsatz der Anführungszeichen entspricht nicht der im Deutschen üblichen Zeichensetzung, manche englische Eigennamen und Titel werden unbeholfen wörtlich übersetzt. So wird aus dem Book of Common Prayer auf S. 29, nicht einmal als Titel gekennzeichnet, schlicht ein „Gebetbuch“. Die englische Anrede eines katholischen Priesters als Father wird durchgehend als Pater übersetzt, obwohl es nicht unbedingt und schon gar nicht ausschließlich einen Ordenspriester bezeichnet – wie Pater im Deutschen. So wird aus dem Weltpriester Dr. Nikolaus Gihr (1839-1924) Pater Nicholas Gihr (vgl. S. 25f). Auch erwähnt wird der schon verstorbene Diözesanpriester und promovierte Kanonist Dr. Gregor Hesse (1953-2006). Dieser Geistliche, der sich selbst gerne als klerikaler Paradiesvogel inszeniert hatte und eine skurrile Vorliebe dafür besaß, mit scheinbar provokant-originellen Formulierungen und Zuspitzungen zu kokettieren, hatte zwar ein Faible für die USA und hielt sich oft und ausgiebig in Zirkeln amerikanischer Traditionalisten exzentrischer Schattierungen auf, war aber trotzdem kein Pater Gregory Hesse (vgl. Endnote 50, S. 83f, hier: S. 83), sondern Österreicher und gebürtiger Wiener. Wenn dem Übersetzer solche Informationen zu den im Text vorkommenden Autoren und Persönlichkeiten gefehlt haben, hätte es zur Sorgfalt der Übersetzungsarbeit gehört, sich diese Kenntnisse im Vorfeld oder spätestens während der Übertragung ins Deutsche zu beschaffen.
Die genannten Beispiele sind nicht die einzig möglichen und willkürlich herausgegriffen. Auch sonst sind die Formulierungen der Übersetzung häufig holprig, oder der Satzbau und Kasusgebrauch sind zumindest seltsam, wenn nicht regelrecht falsch (vgl. beispielsweise den Satz, der S. 48 unten beginnt und sich bis S. 49 oben erstreckt). Vorrang haben aber nicht derlei Schönheitsfehler, sondern die inhaltliche Aussage, deren Gewicht mich alles in allem eine klare Empfehlung, zur hiermit vorgestellten Lektüre zu greifen, aussprechen lässt.
Bibliographische Angaben und Bestellmöglichkeit:
Foto: Statue des hl. Petrus – Bildquelle: Kathnews