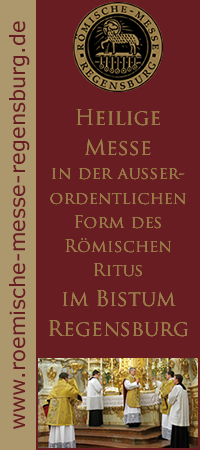Brückenschlag zum mosaischen Judentum

Der Beginn des bürgerlichen Jahres am 1. Januar ist stets der achte Tag der weihnachtlichen Festwoche, der Oktavtag von Weihnachten. In den liturgischen Büchern der Editio typica von 1962 ist das auch seine alleinige Bezeichnung. Der jahrhundertealte Zusatz: In Circumcisione Domini – Bei der Beschneidung des Herrn, war bereits damals weggefallen. Freilich, ohne seinerzeit in die liturgischen Texte einzugreifen.
Änderung mit der Liturgiereform Pauls VI.
Mit der nachkonziliaren Kalenderreform wurde der Tag zum Hochfest der Gottesmutter. Einen marianischen Charakter hatte der Tag immer schon besessen, was wir beim Betrachten seines Messformulars bemerken können, er war allerdings im Breviergebet stärker als in der Messliturgie präsent und somit dem durchschnittlichen Messbesucher weniger gegenwärtig.
Die Einführung des Hochfestes der Gottesmutter war etwas, dem beispielsweise auch Heinz-Lothar Barth einen positiven Gesichtspunkt abgewinnen kann, insofern nämlich, als damit das zivile Jahr an seinem Beginn und zugleich in seinem gesamten Verlauf ausdrücklich unter den besonderen Schutz der Muttergottes gestellt wird. Betrachtet man diesen Vorgang genauer, so war er an sich aber nur die Verlegung des Festes der Mutterschaft Mariens vom 11. Oktober, die mit der Aufwertung zum Hochfest verknüpft wurde. Dieses Fest der Mutterschaft Mariens war gesamtkirchlich erst von Pius XI. 1931 anlässlich der 1600-Jahrfeier des Konzils von Ephesus verpflichtend gemacht worden, das die Theotokos, Maria als wahre Gottesgebärerin, als Dogma verkündet hatte, um gegen Arius die göttliche Natur Jesu zu verteidigen und die Vorstellung zurückzuweisen, Jesus sei maximal zu irgendeinem späteren Zeitpunkt seines Lebens, etwa bei der Taufe im Jordan, vergöttlicht worden. Dann wäre Maria zwar immer noch die Mutter Jesu, hätte ihn aber nicht als wahren Gott geboren.
Der marianische Charakter der liturgischen Texte der Messe des Oktavtages von Weihnachten kommt vor allem zum Ausdruck in Oration und Postcommunio, darüberhinaus in der Wahl der römischen Stationskirche St. Maria in Trastevere. Zuzugeben ist nun, dass die Beschneidung, die so lange namensgebend war, einzig im Evangelium thematisiert wird. Dieses könnte nicht knapper ausfallen, umfasst es doch nur einen einzelnen Vers: Lk 2, 21.
Zur Wurzel im Judentum stehen – Beschneidung des Herrn neu betonen
Dennoch erreichten die Päpste Benedikt XVI. und Franziskus – selbst von jüdischer Seite – mehrfach Anregungen, den 1. Januar offiziell als Fest der Beschneidung des Herrn wiederherzustellen. In der überlieferten Liturgie wäre es zwar die bloße Rekonstruktion eines Titels für den Oktavtag von Weihnachten, dabei aber nicht bloß von höchster Symbol-, sondern auch von echt substantieller Aussagekraft: Die relativierende Rede davon, Gott sei Mensch, nicht indes Mann geworden, würde damit in ihrer scheinbaren Überzeugungskraft annulliert, denn diese Menschwerdung war konkret und einmalig, Jesus war Mann und als Sohn einer jüdischen Mutter selbst Jude. Das hat Auswirkungen als Stellungnahme gegen jede Art eines christlichen Antijudaismus, erst recht gegen jeden Antisemitismus unter pseudochristlichem Vorwand.
Konkretheit der Menschwerdung in Jesus Christus und Weihevorbehalt des getauften Mannes
Außerdem ist diese Konkretheit der Menschwerdung wesentliches Argument gegen ein Weiheamt der Frau, zumal auch dem Judentum ein Frauenpriestertum immer unbekannt war. Priesterinnen waren vielmehr stets Merkmal paganer Religiosität und in den Kulten der vorchristlichen, griechisch-römischen und allgemein orientalischen Welt verbreitet. Das könnte helfen, den Weihevorbehalt des getauften Mannes besser zu verstehen und nicht – beeinflusst von diversen Gendertheorien – als Ausdruck von Diskriminierung oder neuerdings einer Unentschiedenheit des Geschlechtlichen aufzufassen. Sicherlich steht gerade deshalb die hohe Würde der Mariengestalt sogar häufiger und deutlicher in den liturgischen Texten als die fast beiläufig und jedenfalls nur knapp erwähnte Beschneidung und Namensgebung Jesu.
In der überlieferten Römischen Liturgie wird letztere als Namensfest Jesu am Sonntag zwischen dem 1. und 6. Januar nochmals eigens gefeiert; wenn in diese Zeit kein Sonntag fällt, ist es der 2. Januar. Da Beschneidung und Namensgebung im Judentum miteinander verbunden werden, kann man übrigens sagen, dass schon Johannes Paul II. die Anregung, die innerkatholisch etwa auch vom Wiener Dogmatiker Jan-Heiner Tück vertreten wird, vorweggenommen hatte, indem er den Heiligen Namen Jesu, allerdings fixiert auf den 3. Januar, bereits 2002 wieder als nichtgebotenen Gedenktag in der nachkonziliaren Liturgie ermöglichte.
Der Schutz Mariens für das neue bürgerliche Jahr war im Tages- und Schlussgebet immer schon mit ausgesprochen und würde nicht verlorengehen, wenn der 1. Januar nicht mehr Hochfest der Gottesmutter, sondern auch ganz offiziell wieder Beschneidung des Herrn hieße.
Rangerhöhung auf den 11. Oktober übertragen und beibehalten
Die Aufwertung, die das Fest der Mutterschaft Mariens mit der Verlegung auf den 1. Januar in der Liturgie Pauls VI. erfahren hatte, könnte man beibehalten, indem man es am 11. Oktober begeht und in den liturgischen Büchern von 1962 vom II. Rang in die I. Klasse erhebt. Dort ist übrigens die Postcommunio am 1. Januar und 11. Oktober wortgleich. Ein weiteres Argument, die Änderung im wesentlichen bloß als eine terminliche Verschiebung aufzufassen, die sich umso leichter wieder zurücknehmen ließe.
Das würde nicht zuletzt von mehr historischem Bewusstsein in Bezug auf das Zweite Vatikanische Konzil zeugen, das Johannes XXIII. 1962 nicht umsonst gerade dadurch der Muttergottes anvertrauen wollte, dass er seine Eröffnung auf das Fest der Mutterschaft Mariens am 11. Oktober festsetzte.
Jan-Heiner Tück ist Herausgeber eines kürzlich beim Herder Verlag in Freiburg im Breisgau erschienenen Sammelbandes: Die Beschneidung Jesu. Was sie Juden und Christen heute bedeutet.
Foto: Beschneidung Christi – Bildquelle: Kathnews
UPDATE 02.01.2021, 21:47 Uhr