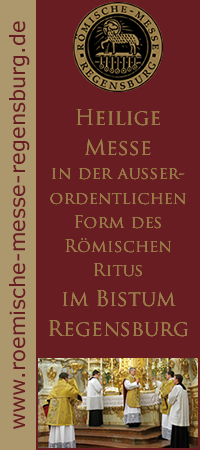Hermeneutik oder Kosmetik der Kontinuität?

Mit der Wahl Joseph Kardinal Ratzingers zum Papst verbanden sich am 19. April 2005 große Hoffnungen und anspruchsvolle Erwartungen. Sie wurden bestärkt von der Erfahrung, dass Ratzinger als Erzbischof von München und Freising und besonders in seinem langjährigen Amt als Präfekt der Glaubenskongregation ein Theologe von Rang und Profil gewesen und geblieben war, der denkerische Virtuosität mit dem klaren Selbstverständnis, Bemühen und Anspruch verknüpfte, in seiner Theologie an die Tradition anzuschließen und theologischen und kirchlichen Fortschritt als Fortsetzung dieser Tradition zu verstehen. Unmittelbar vor der Papstwahl sprach er die Gefahr einer Diktatur des Relativismus an. Diese bildet den Horizont, vor dem Joseph Ratzinger sich stets und seit er als Benedikt XVI. den Petrusdienst ausübt, als Mitarbeiter der Wahrheit (vgl. den bereits bischöflichen Wahlspruch des Papstes, der aus 3 Joh 8 entnommen ist: Cooperatores veritatis) begriffen hat, von der er weiß, überzeugt ist und glaubt, dass sie befreit (vgl. Joh 8, 32).
Als „Panzerkardinal“ wurde er oft missverstanden. Joseph Ratzinger jedenfalls ist an der Spitze der Glaubenskongregation kein Diktator gewesen, und auch als Papst steht er gegen Diktatur, namentlich gegen die Diktatur des Relativismus. Gleichzeitig ist zu beachten, dass im Wahlspruch des Papstes das Wort Mitarbeiter im Lateinischen im Plural steht (cooperatores), was im Deutschen isoliert nicht zu erkennen ist. Zunächst ein Hinweis, dass er sich nicht als der isolierte Genius sieht, sondern Anregung und intellektuellen Austausch mit anderen sucht und sodann dafür, dass er auch als Papst nicht als absolutistischer Monarch agieren will, sondern sich, wie er einmal noch als Kardinal über das Papstamt formuliert hat, nur als den „Hüter der authentischen Tradition und als den ersten Garanten des Gehorsams“ versteht.
Dialektik der Kontinuität
Eine ausgesprochene Antrittsenzyklika hat Benedikt XVI. nicht vorgelegt. Stattdessen ist eine längere Passage in seiner ersten Weihnachtsansprache, die er als Papst an die Kardinäle und andere Mitarbeiter der Römischen Kurie gerichtet hat, die Ansprache vom 22. Dezember 2005, oft als Programm seines Pontifikates verstanden worden. Dieser Abschnitt der Ansprache bildet gewiss eine Art komplementäres Pendant oder die positive Entsprechung zur Benennung einer Diktatur des Relativismus als Gefahr und Herausforderung. Die Passage, die hier gemeint ist, ist diejenige, in der zwei Konzilshermeneutiken einander gegenübergestellt werden, eine „Hermeneutik der Diskontinuität oder des Bruches“ und eine „Hermeneutik der Reform“. Damit bezeichnet der Papst zwei konkurrierende Auslegungszugänge, fast Paradigmen, das II. Vatikanische Konzil zu interpretieren und jeweils mit Ausschließlichkeitsanspruch für sich in Anspruch nehmen, das II. Vaticanum korrekt und der Intentionen der Konzilsväter und –theologen entsprechend umzusetzen. Liest man diesen Text aufmerksam, dann erkennt man, dass es in den Augen Benedikts XVI. eigentlich nicht nur diese Gegenüberstellung einer Bruchhermeneutik und einer Reformhermeneutik gibt, sondern dass letztlich zumindest zwei Bruchhermeneutiken einer Reformhermeneutik gegenüberstehen.
Da der Papst erklärt, dass sich in der Nachkonzilszeit vor allem eine Bruchhermeneutik behauptet und sich gleichsam monopolistisch des Konzils bemächtigt habe, versteht man, dass er bei der Hermeneutik des Bruches zuerst und zahlenmäßig überwiegend an jene denkt, die das II. Vaticanum als eine Abkehr vom Bisherigen und als einen völligen Neubeginn verstanden haben, den sie als einen Bruch mit der Tradition feiern. Es gibt aber auch noch eine sozusagen minoritäre Variante der Bruchhermeneutik seitens derer, die das II. Vatikanische Konzil schon in seinem Ansatz und Konzept sowie in seinen Texten als den absoluten Traditionsbruch kritisieren und die überzeugt sind, die einzig angemessene Weise, das Konzil umzusetzen, sei es, es nicht umzusetzen: nur mit der kompromisslosen Abkehr davon könne Glaubenstreue und Anknüpfung an Überlieferung und Tradition der Kirche wieder hergestellt werden. Doch der Papst sieht ebenso klar, dass die von ihm postulierte Reformhermeneutik selbst in der Zeit nach dem Konzil nicht anders als die traditionalistische Spielart der Bruchhermeneutik bloß von einer Minderheit praktiziert worden ist und ihre Früchte bis jetzt nur im Stillen und Verborgenen reifen konnten.. Das ist grundsätzlich eine deutliche Kritik daran, wie das Konzil in den letzten fünfzig Jahren wahrgenommen und umgesetzt worden ist, wahrgenommen auch deshalb, weil die progressive Bruchhermeneutik für sich ein faktisches Aufmerksamkeitsmonopol in den Massenmedien erreichen konnte.
Sodann fällt auf, dass Benedikt XVI. den Hermeneutiken der Diskontinuität nicht einfach eine Hermeneutik der Kontinuität gegenüberstellt, sondern eine Hermeneutik der Reform. Da ist sicherlich vor allem einmal die Absicht leitend, den tonangebenden, lautstarken, Bruchermeneutikern den Begriff der Reform zu entziehen, den sie zusammen mit einer exklusiven Deutungshoheit über das Konzil wie eine Marke oder ein Label für sich beansprucht haben. Hinzu kommt indes, dass Hermeneutik der Kontinuität eigentlich eine popularisierte Ableitung von der ursprünglichen, bewusst gewählten Terminologie des Papstes ist. Später hat er zwar gelegentlich die Prägung Hermeneutik der Kontinuität auch selbst benutzt, sie ist aber missverständlich, weil sie den Eindruck erwecken könnte, Papst Benedikt behaupte das Bestehen oder fordere eine ausschließliche oder strikt homogene Kontinuität. Dann müsste man angesichts der historischen Erfahrung und Realität tatsächlich von einem utopischen, unzutreffenden Geschichtsverständnis sprechen oder prägnant und desillusioniert von einer „Lüge der Kontinuität“ im II. Vatikanischen Konzil, wie traditionalistische Kritik es erst jüngst getan hat, nämlich Weihbischof Bernard Tissier in seiner Fuldaer Predigt am 2. September 2012. Doch eine solche Behauptung oder Forderung ist nicht gemeint.
Genausowenig allerdings wie die nicht selten anzutreffende Deutung, Hermeneutik der Reform besage ein Zusammenspiel von Kontinuität und Diskontinuität oder Innovation. Es kann zwar in der Sicht Benedikts XVI. legitime Diskontinuitäten geben, und es gibt sie tatsächlich. Legitim sind sie, wenn damit auf veränderte Umstände und Situationen reagiert wird und gerade nur durch eine solche modifizierte Reaktion die Identität der Position der Kirche und ihre Prinzipientreue gewahrt werden kann.
Exkurs: Das Beispiel modifizierter kirchlicher Haltungen zur Religionsfreiheit
In der Ansprache vom 22. Dezember 2005 wählt der Papst für eine solche Treue zu Grundsatz und Identität das Beispiel der Haltung der Kirche zur Religionsfreiheit. In einem Staat, der sich selbst als eine Größe mit metaphysischem Anspruch verstand, musste die Kirche von ihm fordern, diesen metaphysischen Anspruch mit ihrem metaphysischen Anspruch zur Deckung zu bringen und ihr den Status der privilegierten Staatsreligion einzuräumen. Ob dies während des II. Vaticanums bereits der Fall war, müsste eigens untersucht werden, aber inzwischen ist die Diagnose sicherlich zutreffend, dass der real existierende Staat den Nimbus des Metaphysischen abgestreift hat und seine Aufgabe nurmehr in der Organisation einer pragmatisch funktionierenden Gesellschaft sieht.
Gegenüber einem solchen, radikal säkularisierten Staatsverständnis, in dem überhaupt keine Staatsreligion mehr Platz hätte, ist der Einsatz für Religionsfreiheit plötzlich der Einsatz dafür, dass Religion im öffentlichen Raum überhaupt vorkommt, dass nicht eine Diktatur des Relativismus in Gestalt einer radikalen, weltanschaulichen Neutralität Religion aus Öffentlichkeit und Gesellschaft überhaupt verdrängt. Wir erkennen in gewandelten Staatsverständnissen und entsprechend gewandelten Reaktionen der Kirche die Identität ihrer Position: Was früher der logische Anspruch sein musste, Staatsreligion zu sein, fordert heute von ihr den Einsatz für Religionsfreiheit. Nicht als negative Religionsfreiheit oder Indifferentismus verstanden, als welche die Päpste des 19. Jahrhunderts sie verurteilt hatten, sondern als Freiraum für Religion auch als Gestaltungskraft im gesellschaftlichen Leben. Beidemale sind der Anspruch und der Einsatz für den Primat des Metaphysischen und der Wahrheitsfrage identisch. Kirchliches Engagement für Religionsfreiheit bedeutet heute, den gesellschaftlichen Resonanzraum zu erhalten, in dem die Einzelnen nicht nur als Privatpersonen, sondern auch als Bürger die Wahrheitsfrage stellen und beantworten können und relevant in Gesellschaft und Politik einbringen, vor allem im ethischen Bereich, doch auch in Religion und Kirche als Institution und gesellschaftlicher Größe.
Nicht bloß Kontinuität, sondern Hermeneutik der Kontinuität
Bestimmte Diskontinuitäten kann es also geben, und manches Mal ist eine veränderte Reaktion, ist Diskontinuität sogar erforderlich, um Identität zu erhalten. Aber diejenigen, die die Hermeneutik der Reform als ein Zusammenspiel von Kontinuität und Innovation missverstehen, übersehen, dass wir über Hermeneutik sprechen. Gleichgültig, ob man sie Hermeneutik der Reform oder der Kontinuität nennt: Eine Hermeneutik ist ein Verständniszugang und Interpretationsschlüssel. Da der Begriff der Reform dem Begriff der Diskontinuität entgegengesetzt wird, ist klargestellt, dass Reform nicht Diskontinuität bedeutet. Hermeneutik der Reform oder Kontinuität sollen daher nach Benedikt XVI. eindeutig besagen, dass die Deutung nicht sowohl von Elementen der Kontinuität, als auch von solchen der Diskontinuität her geschieht, sondern durchaus ausschließlich anhand des Maßstabes der Kontinuität, der gleichbedeutend ist mit dem Maßstab der Reform. Es kann legitime Diskontinuität geben, aber auch legitime Diskontinuität ist nicht der Deutungsschlüssel, sondern das im Kontext der Kontinuität zu Deutende. Wo diese Deutung gelingt, wird Diskontinuität als kohärent und identisch nachgewiesen, nur dadurch selbst in den bestehenden Kontext der Kontinuität einbezogen und legitimiert.
Liturgik der Kontinuität
Das Motu proprio Summorum Pontificum vom 7. Juli 2007, das dann am 14. September 2007 in Kraft trat, wurde von Kennern Ratzingers gleich als Baustein, gewissermaßen sogar als Grund- oder Eckstein einer „Reform der Reform“ verstanden, die Benedikt XVI. schon als Kardinal gefordert hatte. Die hier gemeinte, zu reformierende Reform war die Liturgiereform des II. Vatikanischen Konzils oder noch präziser die nachkonziliare Liturgiereform Papst Pauls VI. Die Prägung von der „Reform der Reform“, die inzwischen zu einem regelrechten Slogan geworden ist, ist tatsächlich nur dann verständlich, wenn man die wiederum hermeneutische Funktion beachtet, die Papst Benedikt in seiner Theologie der Liturgie stets beigemessen hat. Der Gottesdienst der Kirche ist für ihn nicht etwas, das man konzipiert, damit darin eine bestimmte Theologie zum Ausdruck gebracht wird, sondern das gebetete und gelebte Dogma des Glaubens, gleichsam vorgängige liturgische Orthopraxie, aus der Glaubensreflexion, rechtgläubige Theologie und Katechese, letztlich theologische Orthodoxie überhaupt erst entstehen und hervorwachsen.
Dies ist so jedenfalls unstrittig der theoretische, theologische Ansatzpunkt Ratzingers im Verständnis von Liturgie und Liturgiereform. Auch im Bereich der Liturgie darf Reform demnach nicht als Diskontinuität verstanden werden, sondern ist in Kontinuität zu sehen. Von daher bedeutet Reform die Forderung, die nachkonziliare Liturgie so zu feiern, dass sie nicht als Gegensatz zur liturgischen Tradition erscheint, sondern selbst als eine Ausdrucksform dieser liturgischen Tradition der Lateinischen Kirche, der Kirche Roms. Das hat den Papst dazu geführt, im Motu proprio Summorum Pontificum die Unterscheidung einer ordentlichen und einer außerordentlichen Ausdrucksform des einen Römischen Ritus einzuführen. Diese sind im Prinzip zwar gleichwertig, aber kirchenrechtlich ist die Art der Zuordnung von ordentlich und außerordentlich im Motu proprio doch eindeutig:
Die von Paul VI. eingeführten liturgischen Bücher bilden die Norm, der Gebrauch der älteren liturgischen Bücher ist legitim und gleichwertig, aber doch die Abweichung von der Norm. Rein kirchenrechtlich betrachtet ist daher – wenn von einer wechselseitigen Befruchtung beider liturgischer Usus die Rede ist – nicht die historische Präzedenz ausschlaggebend, sondern die rechtliche Priorität, ist also die ältere liturgische Praxis eher an der neueren zu orientieren als umgekehrt. Dies würde jedenfalls dann gelten, wenn eine Reform der Reform wirklich wieder eine Zusammenführung beider Usus anstreben wollte und dabei in eine gemeinsame Editio typica der liturgischen Bücher des Römischen Ritus münden würde.
Ästhetik der Kontinuität
Anhaltspunkte für die Annahme einer solchen Absicht gibt es allerdings nicht. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die neueren liturgischen Bücher in ihrer aktuellen, dritten Editio typica von 2002 neu und in größerer Textreue zum lateinischen Original in die Volkssprachen zu übersetzten sind. Im englischsprachigen Raum ist es schon geschehen, im deutschen Sprachraum steht es noch bevor. Die prominenteste Änderung ist die Rückkehr zur exakten volkssprachlichen Wiedergabe des lateinischen „pro multis“ bei der eucharistischen Konsekration des Kelches. Diese Übersetzungsarbeit beweist, dass in absehbarer Zeit nicht mit einer tiefgreifend veränderten Editio typica der Bücher des Usus ordinarius oder gar mit einer Editio typica zu rechnen ist, aus der ein wieder eingestaltiger Römischer Ritus resultieren würde, der gleichermaßen die großen Linien der liturgischen Tradition, die Grundsätze und Anliegen der Konzilskonstitution über die heilige Liturgie und das in vierzigjähriger, nachkonziliarer Liturgiepraxis wirklich Gereifte und Bewährte integriert.
Im Wesentlichen scheint es Papst Benedikt dabei bewenden lassen zu wollen, also auch ausreichend zu finden, in seinen eigenen, liturgischen Feiern das Beispiel und Vorbild einer „Ars celebrandi“ zu geben, die in Formensprache und Stil an die Kontinuität liturgischer Tradition anknüpft: Verwendung klassischer Paramente, traditionelle Kirchenmusik und Weihrauch, eine bestimmte Förderung des Lateins, Bevorzugung männlicher Ministranten und der traditionellen Weise des Kommunionempfanges, vielleicht auch noch der Gebetsostung liturgischer Feiern – bei all dem fällt auf, dass es bei gewissermaßen unverbindlichen Anregungen bleibt, die jene aufgreifen, die sich mit Ratzingers Theologie und liturgischer Ästhetik identifizieren, sozusagen seine Fans, die aber ansonsten weithin wirkungslos und sogar unbemerkt bleiben. Wird ein künftiger Papst das Beispiel dieser „Ars celebrandi“ fortsetzen oder selbst wieder einen ganz anderen liturgischen Stil favorisieren? Es ist ungewiss.
Hierzu ist zu sagen, dass ohnehin all diese äußeren Merkmale und Elemente prinzipiell nichts über die Qualität einer Liturgie aussagen. Ja, in den frühen lutherischen Liturgien, die das Konzil von Trient verurteilt hat, waren diese Elemente sogar besonders irreführend und verführerisch, weil diese Liturgien lutherischer Prägung die überlieferte Form der Liturgie der Lateinischen Kirche weitgehend und sogar ziemlich lange so bewahrten, wie sie in den von der Reformation betroffenen Gebieten bis zu Glaubensspaltung ausgeprägt worden war. Die lutherische Reformation vollzog sich schleichend und liturgisch und ausgerechnet deswegen so erfolgreich, weil sanft und unter Wahrung großer liturgischer Kontinuität und Ähnlichkeit, obwohl im Kern schon längst ein andersartiger Inhalt eingetreten war. Davor musste das Konzil von Trient ausdrücklich warnen (vgl. ritus novi et alii, in DH 1613), weil bei den Lutheranern der Bruch – anders als in den Predigtgottesdiensten der Reformierten – zwar genauso wesentlich und radikal, aber äußerlich kaum auf Anhieb festzustellen war.
Damit sollen nicht die liturgischen Bücher Pauls VI. oder die Praxis nachkonziliaren Gottesdienstes pauschal auf eine Ebene mit diesen lutherischen Liturgien in der reformatorischen Frühphase gestellt werdeb, es soll aber bewusst gemacht werden, dass ästhetische Kontinuität gegebenenfalls gerade über liturgische Defizite, die freilich nicht automatisch immer gleich dogmatische Defekte sein müssen, hinwegtäuschen kann und diese überlagert. Auf diese Weise werden Spannungen verschleiert, nicht gelöst. In diesem Fall kehrt sich eine Ästhetik der Kontinuität in eine Problematik der Kontinuität um.
Solange es nicht zu einer echten „Reform der Reform“ im Sinne einer wieder einheitlichen Editio typica der liturgischen Bücher des Römischen Ritus kommt oder kommen kann, wäre bei aller gebotenen Hochachtung eine einseitige rituelle Angleichung der älteren liturgischen Bücher an die neueren von den Ecclesia-Dei-Gemeinschaften und allen, die sich auf Summorum Pontificum stützen, entschieden zurückzuweisen und zu verweigern. Hätte der Heilige Vater 2007 der gesamten Lateinischen Kirche beispielsweise das eigentliche Messbuch des II. Vaticanums gemäß der Liturgiekonstitution auferlegt, das Missale von 1965 und für dieses als Möglichkeit eine breite Verwendung der Volkssprache gestattet und gegebenenfalls noch bewährte Elemente des paulinischen Messbuchs als Optionen integriert, wäre das hingegen ohne weiteres akzeptabel gewesen. Dann hätte man sich sogar damit abfinden können, dass das Missale von 1962 beispielsweise nur in monastischen Gemeinschaften verwendet worden wäre oder bei speziellen, nicht regelmäßigen Anlässen, beziehungsweise an hohen Feiertagen. Weil auf diese Weise die gesamte Lateinische Kirche klar und verbindlich wieder in die liturgische Tradition rückgebunden worden wäre, hätten dann Priester und Gläubige aus dem Bereich von Summorum Pontificum bestimmte, ästhetische, liturgische Vorzüge und Vorlieben opfern müssen und auch opfern können. Doch es ist klar, dass das praktisch bereits nicht mehr umzusetzen gewesen sein würde.
Kosmetik der Kontinuität
Kontinuität wird problematisch, wenn an die Stelle einer Hermeneutik der Kontinuität eine Kosmetik der Kontinuität tritt. Auch die liturgischen Impulse Benedikts XVI. sind nur hermeneutisch zu verstehen. Wenn es stimmt, dass dem Generaloberen der Priesterbruderschaft St. Pius X., Weihbischof Bernard Fellay, auf dessen Bitte hin, die bleibenden Probleme, die in seiner Gemeinschaft mit einer Hermeneutik der Kontinuität gesehen werden, in einer weiteren Audienz erläutern zu dürfen, jüngst einfach mitgeteilt wurde, dass das Konzil angenommen werden soll, dann ist bei diesem angeblich sogar handschriftlichen Brief des Papstes offenbar der jüngste Umschwung in der Führung der Glaubenskongregation federführend gewesen, den es ohne eine bestimmte Personalentscheidung so nicht geben würde.
Die Pauschalität der Forderung nach „Anerkennung“ des II. Vaticanums entspricht nicht der klaren Kenntnis des Heiligen Vaters vom speziellen Eigencharakter des II. Vatikanischen Konzils und der bewusst gestuften Rangordnung seiner Dokumente. Diese Rangordnung sollte wahrscheinlich sogar den Verzicht auf dogmatische Canones, den man gerne als Unterschied zu den bisherigen Ökumenischen Konzilien anführt, gewissermaßen kompensieren. Umso wichtiger ist es, diese Rangunterschiede nicht nachträglich einzuebnen, indem man alle Dokumente gleichsam auf die Ebene der Konzilskonstitutionen anhebt. Natürlich kann die Priesterbruderschaft St. Pius X. ihrerseits den Charakter des II. Vaticanums als eines legitimen Ökumenischen Konzils nicht bestreiten und das Vorhandensein jeder Kontinuität nicht gänzlich oder überwiegend in Abrede stellen. Freilich kann sie darauf bestehen, dass die Hermeneutik der Kontinuität konkret verbindlich sein muss, um überzeugen zu können. Ich selbst bin überzeugt, dass legitime Diskontinuität, die sogar notwendig ist, um wesentliche Identität des Standpunkts zu wahren, am Beispiel der Religionsfreiheit am besten aufzuzeigen ist. Es kann aber sein, das andere das anders sehen oder dass es auch noch weitere, konkrete Punkte gibt, wo die Legitimität einer bestimmten Diskontinuität nicht auf Anhieb offensichtlich ist.
Wenn man sich vor Augen führt, dass Benedikt XVI. am 22. Dezember 2005 einerseits zwar eingeräumt hat, dass eine authentische Hermeneutik der Reform nach dem Konzil bisher nur von einer Minderheit und auch nur im Verborgenen und Stillen praktiziert worden ist, andererseits aber keine verbindlichen Korrekturen an der breiten und lärmenden, progressiven Bruchhermeneutik durchgesetzt hat, kann man sich fragen, ob am Ende nicht doch manches bloß eine oberflächliche Kosmetik der Kontinuität ist und außerdem, welche Haltbarkeit eine solche Kosmetik der Kontinuität über das gegenwärtige Pontifikat hinaus wohl haben kann. Diese Fragen zu klären, ist entscheidend, wenn die von den Deutschen Bischöfen in ihrem Wort zum Auftakt des Konzilsjubiläums geäußerte Feststellung bleibende Geltung behalten und entfalten soll, dass das II. Vatikanische Konzil „eine grundlegende Erneuerung eingeleitet hat, die das Leben der Kirche prägt und auch zukünftig prägen wird.“
In seiner insgesamt überaus bemerkenswerten Predigt, die der Limburger Bischof Dr. Franz-Peter Tebartz-van Elst am 27. September 2012 in der Schlussandacht der Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda gehalten hat, ist er unter anderem von einem Papstwort Johannes Pauls II. ausgegangen: „Heilige veralten nie; sie verlieren nie ihre Gültigkeit. Sie bleiben ständig Zeugen für die Jugend der Kirche. Sie werden nie Menschen der Vergangenheit, Männer und Frauen von gestern. Im Gegenteil: Sie sind immer Männer und Frauen von morgen, Menschen der im Evangelium verheißenen Zukunft. Zeugen der kommenden Welt.“ Dieses Zitat zeichnet uns ein Bild von den Heiligen, das sie uns als Männer und Frauen der Identitätstreue, der Tradition und der Kontinuität vor Augen stellt. Beherzigt man dies recht, dann ist die Hermeneutik der Kontinuität mehr als die intellektuelle Spielerei einer Theologie im elfenbeinernen Turm, mehr als Kosmetik oder Beschwichtigung von 500 Unglückspropheten und Bedenkenträgern in den Waliser Bergen, dann ist sie der Weg und die Schule des Glaubens und der Heiligkeit und soll uns durch das Jahr des Glaubens begleiten und in die Zukunft der Kirche führen. Dann darf sie nicht Alibi-Funktion bekommen oder der Kitt sein, der echte Risse nur notdürftig überdeckt, die schließlich doch aufbrechen. Dann darf davon nicht die Fußnote zum gescheiterten Versuch übrigbleiben, eine neue Spaltung der Christenheit in der Kirche zu vermeiden; erst recht nicht daraus der missbräuchliche Vorwand werden, eine solche Spaltung zu provozieren.
Foto: Papst Benedikt XVI. – Bildquelle: Fabio Pozzebom/ABr