Heilige Schrift und Glaube der Kirche
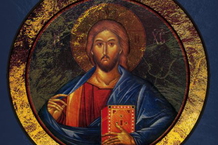
Es folgen die Texte des Katechismus der Katholischen Kirche zu den Lesungen vom 9. Sonntag im Jahreskreis in der sog. ordentlichen Form des Römischen Ritus (Zusammenstellung: Gero P. Weishaupt. Quelle: Homiletisches Direktorium der Kongregation fĂŒr den Gottesdienst und die Sakramentenordnung).
 Aus der heiligen Schrift
1 Kön 8, 41-43
Herr, höre an den Fremden, der zu dir betet.
Gal 1, 1-2. 6-10
Wollte ich noch den Menschen gefallen, dann wÀre ich kein Knecht Christi.
Lk 7, 1-10
Nicht einmal in Israel habe ich einen solchen Glauben gefunden.
Aus dem Katechismus der Katholischen Kirche
Alle sind zum Reich Gottes berufen
543 Alle Menschen sind berufen, in das Reich einzutreten. Dieses messianische Reich wird zunĂ€chst den Kindern Israels verkĂŒndet [Vgl. Mt 10,5-7.], ist aber fĂŒr die Menschen aller Völker bestimmt [Vgl. Mt 8,11; 28,19.]. Wer in das Reich eintreten will, muĂ das Wort Jesu annehmen.
,,Denn das Wort des Herrn wird mit einem Samen verglichen, der auf dem Acker gesĂ€t wird: die es im Glauben hören und der kleinen Herde Christi zugezĂ€hlt werden, haben das Reich selbst angenommen; aus eigener Kraft keimt dann der Same und wĂ€chst bis zur Zeit der Ernte“ (LG 5).
544 Das Reich gehört den Armen und Kleinen, das heiĂt denen, die es demĂŒtigen Herzens angenommen haben. Jesus ist gesandt, damit er ,,den Armen Frohbotschaft bringe“ (Lk 4,18) [Vgl. Lk 7,22.]. Er preist sie selig, denn ,,ihnen gehört das Himmelreich“ (Mt 5,3). Den ,,Kleinen“ wollte der Vater offenbaren, was den Weisen und Klugen verborgen bleibt [Vgl. Mt 11,25.]. Von der Krippe bis zum Kreuz teilt Jesus das Leben der Armen; er kennt Hunger [Vgl. Mk 2,23-26; Mt 2l,18.], Durst [Vgl. Joh 4,6-7; 19,28.]und Entbehrung [Vgl. Lk 9,58.].Mehr noch: Er identifiziert sich mit den Armen aller Art und macht die tĂ€tige Liebe zu ihnen zur Voraussetzung fĂŒr die Aufnahme in sein Reich [Vgl. Mt 25,31-46.].
Die Kirche als universales Heilssakrament
774 Das griechische Wort âmysterion“ [Geheimnis] wurde auf lateinisch durch zwei AusdrĂŒcke wiedergegeben durch âmysterium“ und âsacramentum“. In der spĂ€teren Deutung drĂŒckt der Begriff âsacramentum“ mehr das sichtbare Zeichen der verborgenen Heilswirklichkeit aus, die mit dem Begriff âmysterium“ bezeichnet wird. In diesem Sinn ist Christus selbst das Heilsmysterium: âDas Mysterium Gottes ist nichts anderes als Christus“ (Augustinus, ep. 187,11,34). Das Heilswerk seiner heiligen und heiligenden Menschennatur ist das Heilssakrament, das sich in den Sakramenten der Kirche (die von den Ostkirchen auch als âdie heiligen Mysterien“ bezeichnet werden) bekundet und in ihnen wirkt. Die sieben Sakramente sind die Zeichen und Werkzeuge, durch die der Heilige Geist die Gnade Christi, der das Haupt ist, in der Kirche, die sein Leib ist, verbreitet. Die Kirche enthĂ€lt und vermittelt also die unsichtbare Gnade, die sie bezeichnet. In diesem analogen Sinn wird sie âSakrament“ genannt.
775 âDie Kirche ist in Christus gleichsam das Sakrament, das heiĂt Zeichen und Werkzeug fĂŒr die innigste Vereinigung mit Gott und fĂŒr die Einheit des ganzen Menschengeschlechts“ (LG 1). Das erste Ziel der Kirche ist, das Sakrament der tiefen Vereinigung der Menschen mit Gott zu sein. Weil die Gemeinschaft unter den Menschen in der Vereinigung mit Gott wurzelt, ist die Kirche auch das Sakrament der Einheit des Menschengeschlechtes. In ihr hat diese Einheit schon begonnen, denn sie sammelt Menschen âaus allen Nationen und StĂ€mmen, Völkern und Sprachen“ (Offb 7,9). Gleichzeitig ist die Kirche âZeichen und Werkzeug“ des vollen Zustandekommens dieser noch ausstehenden Einheit.
776 Als Sakrament ist die Kirche Werkzeug Christi. Die Kirche ist in den HĂ€nden Christi âWerkzeug der Erlösung aller“ (LG 9), âallumfassendes Sakrament des Heiles“ (LG 48), durch das Christus die âLiebe Gottes zum Menschen zugleich offenbart und verwirklicht“ (GS 45,1). Sie ist âdas sichtbare Projekt der Liebe Gottes zur Menschheit“ (Paul VI., Ansprache vom 22. Juni 1973). Diese Liebe will, âdaĂ das ganze Menschengeschlecht ein einziges Volk Gottes bilde, in den einen Leib Christi zusammenwachse und zu dem einen Tempel des Heiligen Geistes aufgebaut werde“ (AG 7) [Vgl. LG 17].
Salomos Gebet bei der Tempelweihe
2580 Der Tempel von Jerusalem, das Haus des Gebetes, das David errichten wollte, wird von seinem Sohn Salomo gebaut. Das Gebet bei der Tempelweihe [Vgl. 1 Kön 8,10-61] stĂŒtzt sich auf die VerheiĂung Gottes und auf den Bund mit ihm, auf die handelnde Gegenwart seines Namens in seinem Volk und auf die Erinnerung an die groĂen Taten beim Auszug aus Ăgypten. Der König erhebt die HĂ€nde zum Himmel und fleht zum Herrn fĂŒr sich selbst, fĂŒr das ganze Volk und fĂŒr die kĂŒnftigen Geschlechter um die Vergebung der SĂŒnden und um das, was man jeden Tag braucht. Denn alle Nationen sollen wissen, daĂ der Herr der einzige Gott ist und daĂ das Herz seines Volkes ihm ganz gehört.
Jesus und der Tempel
583 Wie schon die Propheten vor ihm, erwies Jesus dem Tempel von Jerusalem tiefste Ehrfurcht. Vierzig Tage nach seiner Geburt wurde er darin von Josef und Maria Gott dargestellt [Vgl. Lk 2,22-39.]. Im Alter von zwölf Jahren entschloĂ er sich, im Tempel zu bleiben, um seine Eltern daran zu erinnern, daĂ er fĂŒr die Sache seines Vaters da sei [Vgl. Lk 2,46-49..]. WĂ€hrend seines verborgenen Lebens begab er sich Jahr fĂŒr Jahr wenigstens am Paschafest zum Tempel hinauf [Vgl. Lk 2,41.]. Sein öffentliches Wirken vollzog sich im Rhythmus seiner Pilgerfahrten nach Jerusalem zu den groĂen jĂŒdischen Festen [Vgl. Job 2,13-14; 5,1.14; 7,1.10.14; 8,2; 10,22-23.].
584 Jesus steigt zum Tempel hinauf als dem vorzĂŒglichen Ort der Begegnung mit Gott. Der Tempel ist fĂŒr ihn die Wohnung seines Vaters, ein Haus des Gebetes, und er empört sich darĂŒber, daĂ dessen Vorhof zu einem Marktplatz gemacht wird [Vgl. Mt 21,13..]. Aus eifernder Liebe zu seinem Vater vertreibt er die HĂ€ndler aus dem Tempel: âMacht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle! Seine JĂŒnger erinnerten sich an das Wort der Schrift: âDer Eifer fĂŒr dein Haus verzehrt michâ (Ps 69,10)“ (Joh 2,16-17). Nach seiner Auferstehung behielten die Apostel eine ehrerbietige Haltung zum Tempel bei [Vgl. z.B. Apg 2,46; 3,1; 5,20.21.].
585 Vor seiner Passion kĂŒndigte Jesus jedoch die Zerstörung dieses herrlichen GebĂ€udes an, von dem kein Stein mehr auf dem anderen bleiben werde [Vgl. Mt 24,1-2.]. Darin liegt ein Zeichen der Endzeit, die mit seinem Pascha beginnt [Vgl. Mt 24,3;Lk 13,35.].
Diese Weissagung aber wurde bei seinem Verhör vor dem Hohenpriester von falschen Zeugen entstellt wiedergegeben [Vgl. Mk 14,57-58.] und dann dem ans Kreuz Genagelten spöttisch entgegengehalten [Vgl. Mt 27,39-40.].
586 Jesus legte seine Lehre zum groĂen Teil im Tempel dar [Vgl. Joh 18,20.]und war diesem keineswegs feind [Vgl. Mt 8,4; 23,21; Lk 17,14; Joh 4,22..]. Er war gewillt, die Tempelsteuer zu zahlen, und entrichtete sie auch fĂŒr Petrus [Vgl. Mt 17,24-27.], den er eben zum Grundstein seiner kĂŒnftigen Kirche gemacht hatte [Vgl. Mt 16,18.]. Er identifizierte sich sogar mit dem Tempel, indem er sich selbst als die endgĂŒltige Wohnung Gottes unter den Menschen bezeichnete [Vgl. Joh 2,21; Mt 12,6.]. Darum kĂŒndigt die Hinrichtung seines Leibes [Vgl. Joh 2,18-22.] die Zerstörung des Tempels an, mit der eine neue Epoche der Heilsgeschichte anbricht: âDie Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet“ (Joh 4, 21) [Vgl. Job 4, 23-24; Mt 27,51; Hebr 9,11; Offb 21,22.] .
Foto: Jesus der König – Bildquelle: Sarto-Verlag










