Die missio canonica als QualitÃĪtsgarantie der VerkÞndigung
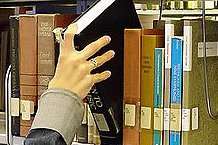
In vielen Pfarreien und kirchlichen Einrichtungen sind Pastoralassistenten eingesetzt, um den Geistlichen hilfreich zur Seite zu stehen und ihnen, wo nÃķtig, zu assistieren. Auch in den Schulen und kirchlichen Bildungseinrichtungen stellen Laienkatecheten den Þberwiegenden Anteil der Lehrpersonen â unterrichtende Priester und Nonnen sind mittlerweile leider die groÃe Ausnahme geworden.
Der Geistlichkeit kommt kraft ihres sakramentalen Weiheamtes auch der Lehr- und Leitungsauftrag zu. Sie sind die ersten Katecheten, welche ihr Lehramt aus der Teilhabe am Priestertum her ableiten, ebenso wie die Leitungsaufgaben den Geistlichen kraft sakramentaler VerfÞgung zukommen und diese letztlich nicht delegierbar sind, was aber nicht bedeutet daà sich der AmtstrÃĪger in gewissen Bereichen assistieren lassen kann und darf, ohne jedoch dabei seine aus der Weihe kommenden Vollmachten zu Þbertragen. (DiesbezÞglich wÃĪre im Ãbrigen auch die de facto vorliegende Funktion mancher PfarrgemeinderÃĪte neu zu ÞberprÞfen und gegebenenfalls zu korrigieren.)
Da Laien durch die ihnen Þbertragenen Aufgaben auch den Bereich der Lehre berÞhren, sowie in ihrer alltÃĪglichen Arbeit die Kirche auch nach auÃen hin vertreten (es werden RÞckschlÞsse gezogen und Kirchenbilder geprÃĪgt), schien es der Kirche angebracht, der Arbeit von Religionslehrern und Pastoralassistenten, sowie allen die im Namen der Kirche sprechen und so VerkÞndigung betreiben mit einer offiziellen Sendung zu versehen.
Diese Sendung hat einen zweifachen Charakter, nÃĪmlich einen liturgischen sowie einen kanonischen. Eine Missio canonica ist nicht einfach eine schÃķne Feier, sie ist auch nicht dazu da den zu Sendenden ins Rampenlicht zu stellen, sondern sie macht in ihrer liturgischen Ausfaltung klar, daà die Aufgaben welche der zu Sendende Þbernimmt keine persÃķnlichen Beliebigkeiten zulÃĪÃt, sondern durch die Kirche konditioniert sowie Ãķffentlich sind. In der kanonischen Ausfaltung, welche mittels Dekret erfolgt, wird das, was im Liturgischen seinen Ausdruck findet seitens des Gesandten als schwere Verpflichtung Þbernommen. Der Gesandte verpflichtet sich also auf die Lehre und die Praxis der Kirche.
Die Mission canonica hat dabei einen doppelten Aspekt:
Der Gesandte macht sich die Lehre der Kirche zu eigen
Ein erster Aspekt bezieht sich auf das eben Gesagte: es betrifft den der sich die Sendung erteilen lÃĪÃt, indem er sich als Gesandter in den Dienst des Sendenden stellt. Diese Art der Indienstnahme ist sicherlich weniger umfassend als jene einer Weihe weil sie PrivatrÃĪume lÃĪÃt und nicht das gesamte Leben beansprucht. Dennoch ist es aber keine Indienstnahme welche sich mit Arbeitszeiten begrenzen lÃĪÃt, sondern sie erstreckt sich auf all jene Bereiche, welche die kirchliche Lehre und Disziplin in irgendeiner Weise berÞhren.
Sie setzt die Bereitschaft voraus, der Kirche gegenÞber Loyal und ergeben zu sein, ihre Lehren unverkÞrzt zu vertreten und nicht gegen sie zu agieren. Es wÞrde keinen Sinn ergeben wÞrde man sich zu etwas senden lassen, was man inhaltlich eigentlich nicht teilt. Wo die hierarchische Kirche und das Lehramt als GegenÞber aufgefaÃt werden, mangelt es an einem sensus communis, welcher eine wesentliche Grundlage fÞr einen gedeihlichen VerkÞndigungsdienst bildet und ohne den es mehr zu Schaden als zu Nutzen kommt.
Niemand wird gezwungen fÞr die Kirche zu arbeiten, doch wer dies tun will ist, wie Þberall, an bestimmte Grundvoraussetzungen gebunden. Wer also fÞr die Kirche arbeiten mÃķchte, tut dies freiwillig und ist daher auch freiwillig bereit, die Lehre der Kirche zu vertreten. Man kann nicht fÞr etwas arbeiten, wogegen man eigentlich ist. Durch das Faktum, daà sich jemand von der Kirche senden lÃĪÃt um fÞr diese zu arbeiten und ihre Lehre zu verkÞnden sagt diese Person aus, sich mit der Kirche und ihrer Lehre zu identifizieren, diese und nichts anderes fÃķrdern zu wollen und der Kirche treu und loyal ergeben zu sein.
Die Kirche bestÃĪtigt durch die Missio die kirchliche und lehrkonforme Haltung des zu Sendenden
Ein zweiter Aspekt bezieht sich auf die Kirche selbst. Ihre Sendung soll dem glÃĪubigen Volk als QualitÃĪtssiegel gelten kÃķnnen, daà der Gesandte auch wirklich die authentische Lehre der einen Kirche Jesu Christi vertritt, dieser loyal ergeben ist und somit auch als vertrauenswÞrdig gilt. Durch die Erteilung der Missio erklÃĪrt die Kirche also auch den GlÃĪubigen, daà sie der Ãberzeugung ist, der Kandidat habe dieselben Ãberzeugungen als sie selbst, sie versichert daà die jeweilige Person, soweit es der Kirche zu erkennen freilich mÃķglich ist, die Lehre der Kirche zueigen gemacht hat und dasselbe verkÞndet als es auch die Kirche tut. Nur so kann VerkÞndigung Þberhaupt funktionieren, denn wÞrde jeder erklÃĪren was er aus sich selbst heraus erdacht hat oder fÞr richtig hÃĪlt, wÞrde der verbindende gemeinsame Glaube der Kirche sich auflÃķsen und somit auch die kirchliche Gemeinschaft zerfallen, sowohl jene untereinander, besonders aber jene mit Gott.
Deshalb muà die Kirche prÞfen, urteilen und erst dann kann die missio canonica erteilt werden. Sie darf nicht zu einer reinen FormalitÃĪt verkommen, bzw. wo dies bereits geschehen ist muà dieser Tendenz wieder Einhalt geboten werden.
Die Praxis ist zu Þberdenken
In der Praxis sieht es so aus, daà die missio canonica vielfach gleichsam automatisch erteilt wird. Das hat unter anderem darin seinen Grund, daà ein gegenteiliges Verhalten seitens des Ortsordinarius zu einem innerdiÃķzesanen und medialen Aufschrei fÞhren wÞrde. Das geht jedoch zur Lasten der GlÃĪubigen, fÞr welche die erteilte Missio ein vertrauenswÞrdiges QualitÃĪtsmerkmal mehr darstellen kann und auf Kosten der Kirche weil diese Schaden davon trÃĪgt.
Leider sagt die missio nicht mehr das aus was sie aussagen sollte, ÃĪhnlich wie auch ein QualitÃĪtssiegel eines KÃĪses Wert und Aussagekraft verliert, wenn auch solche KÃĪse damit ausgezeichnet werden, die nicht den Kriterien entsprechen welche das QualitÃĪtssiegel vorschreibt.
Da es zur SelbstverstÃĪndlichkeit wurde am Ende der Ausbildung die kirchliche Sendung zu erhalten gÃĪlte es als Skandal, wenn diese Sendung einmal nicht erteilt oder entzogen wÞrde. Doch was solch ein skandalÃķser Fall wÃĪre, ist im Grunde genommen normales kirchliches Leben: can 804 §2 des CIC sagt im Bezug auf die Religionslehrer: âDer Ortsordinarius hat darum bemÞht zu sein, daà sich diejenigen, die zu Religionslehrern in den Schulen, auch den nichtkatholischen, bestellt werden sollen, durch RechtglÃĪubigkeit, durch das Zeugnis christlichen Lebens und durch pÃĪdagogisches Geschick auszeichnen.â Analog gilt dies auch fÞr die Pastoralassistenten. Und in Can 805 heiÃt es: âDer Ortsordinarius hat fÞr seine DiÃķzese das Recht, die Religionslehrer zu ernennen bzw. zu approbieren und sie, wenn es aus religiÃķsen oder sittlichen GrÞnden erforderlich ist, abzuberufen bzw. ihre Abberufung zu fordern.â
Es ist ein Irrtum zu glauben, ein abgeschlossenes Theologiestudium berechtige zur AusÞbung kirchlicher Berufe â es befÃĪhigt zwar, jedoch entwÃĪchst daraus noch kein Recht. Erst die missio ist die Berechtigung, weshalb diese aber mit Vorsicht und Bedacht zu erteilen ist.
Es ist Eltern und GlÃĪubigen nicht zuzumuten, in den Schulen und Pfarrgemeinden Religionslehrer und Pastoralassistenten eingesetzt zu sehen, welche gegen die Glaubenslehre, gegen die Kirche und deren Hierarchie sowie gegen das kirchliche Gesetz reden und handeln. Hier greift die Verantwortung des DiÃķzesanbischofs, welchem die Oberaufsicht Þber die Reinhaltung von Lehre und Ordnung in seinem Bistum obliegt. Im letzten geht es hier um einen Schutz der GlÃĪubigen.
Freilich ist es nicht immer vorherzusehen wie jemand sich im konkreten BetÃĪtigungsfeld verhalten wird. Aber wo Haltungen und Ansichten bekannt sind, welche nicht mit jenen der universalen Kirche Þbereinstimmen, darf den GlÃĪubigen auch nicht durch einen offiziellen, rechtswirksamen Auftrag suggeriert werden, daà es sich um kirchliche Lehre handle.
Foto: Bibliothek – Bildquelle: Joe Crawford










