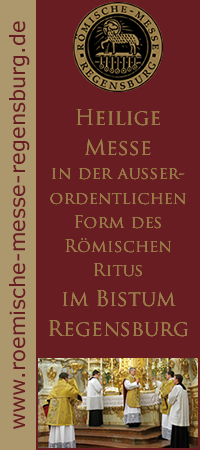Die Kontinuität von Papst Franziskus und Benedikt XVI. – Zur Kontinuitätsidee bei Joseph Ratzinger

Seit Benedikt XVI. das Papstamt abgelegt und Papst Franziskus dieses Amt angetreten hat, beobachtet man zweierlei, oder besser: eine zweifache Reaktion. In den Medien wurde von Anfang an ein Gegenbild entworfen. Ratzinger, der Konservative, vielleicht sogar der finstere Traditionalist, auf der einen Seite, Franziskus, der Weltoffene, Fortschrittszugewandte, auf der anderen, der nach dem rückfallsartigen Zwischenspiel einer vorkonziliaren Retardierung im Ratzingerpontifikat jetzt endlich den vollen Reformimpuls des Zweiten Vaticanum konsequent und energisch in die Tat umsetze. So die erste, öffentlich breite, Reaktion, der sich progressive Kirchenkreise begeistert anschließen. Doch manch innerkirchlich Konservative, die im Pontifikat Ratzingers die eigenen Anliegen und Sichtweisen weitgehend oder sogar zur Gänze vertreten sahen, wollen, möglicherweise, weil Benedikt ja nur Amtsverzicht geleistet hat und nicht gestorben ist, auch die Erwartungen und Hoffnungen, die sie mit ihm verbanden, (noch) nicht begraben. Sie lassen deshalb, häufig sehr irrational, höchstens stilistische Unterschiede zwischen den beiden Päpsten Benedikt und Franziskus gelten, bestehen aber mit angestrengtem, unnachgiebigem Nachdruck auf inhaltlich vollständiger Übereinstimmung des argentinischen Papstes mit seinem deutschen Vorgänger. Ich persönlich halte beide Reaktionsweisen für sachlich und inhaltlich unzutreffend und daher für falsch und zwar gerade darum, weil es tatsächlich eine große thematisch-inhaltliche Übereinstimmung Ratzingers mit Papst Franziskus gibt.
Vom Schlüssel- zum Zauberwort: Kontinuität
Die Weihnachtsansprache, die Papst Benedikt 2005 an die Mitarbeiter der Römischen Kurie gerichtet hat, enthält einen Passus über das Zweite Vatikanische Konzil, dessen Interpretation und Umsetzung. Diesem Passus entstammt die Prägung der Reformhermeneutik, die Benedikt vom Leitmotiv der Kontinuität her verstand und der er die Hermeneutik des Bruches als weit verbreitet, aber verfehlt entgegensetzte. Vielleicht, weil Benedikt niemals im eigentlichen Sinne eine Antrittsenzyklika vorgelegt hat, wurde diese Gegenüberstellung von Hermeneutik der Reform und Hermeneutik der Diskontinuität vor allem von überzeugten Ratzingerianern als programmatisch für das Pontifikat Benedikts wahrgenommen und, kritisch formuliert, teilweise regelrecht ausgeschlachtet. Im Rückblick und in einer Gewichtung der tatsächlich erzielten Wirksamkeit dieses Ansatzes während seines Pontifikates kann man sicher die Frage stellen, ob hier nicht eine Überbewertung vorliegt, die dem Gemeinten weder formal, noch der Sache nach gerecht werden kann. Faktisch war es so, dass Kontinuität anschließend als Schlüsselwort des gesamten Pontifikats Benedikt XVI. erschien und konservative und traditionalistische Wünsche, Erwartungen und Hoffnungen, vor allen Dingen aber wohl Projektionen an sich knüpfte. Mit dem Amtsantritt des neuen, in vielem so unkonventionellen Papstes wurde der Begriff der Kontinuität weithin bald vergessen, gegenüber den Konservativen, deren Papstbegeisterung auch für Bergoglio gewonnen werden sollte, aber zum Beruhigungsmittel oder zum Zauberwort der Beschwichtigung. Eine Kritik, von der man sogar Erzbischof Georg Gänswein nicht vollständig ausnehmen kann.
Herkunft der Kontinuitätsidee bei Joseph Ratzinger
Dafür, dass Benedikt XVI. selbst seiner Weihnachtsansprache und auch der Hermeneutik der Reform in Kontinuität eine programmatische Stellung beigemessen wissen wollte, spricht der wenig beachtete Umstand, dass er seinen Kontinuitätsbegriff offenbar ebenfalls der Ansprache eines Konzilspapstes, Pauls VI., an die Römische Kurie entnommen hat. Gemeint ist die Ansprache am 21. September 1963, in der Papst Montini über die Kurienreform und deren Bedeutung für das Reformvorhaben des Konzils sprach. Ratzinger schrieb damals kommentierend, man dürfe ohne Übertreibung sagen, diese Rede stelle nicht nur ein Stück Kurien- und Papstgeschichte, sondern auch ein Stück Konzilsgeschichte dar (vgl. Ratzinger, J., Zur Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils, Tbd. 7/1 der Gesammelten Schriften, (Herder) Freiburg i. Br. 2012, S. 362). Aus dieser damaligen Einschätzung des Konzilstheologen lässt sich vielleicht die Erwartung oder zumindest der insgeheime Wunsch des Ratzingerpapstes ableiten, mit seiner Kurienansprache im Blick auf das Zweite Vaticanum und dessen Interpretation gleichfalls Papst- und Konzilsgeschichte zu schreiben.
Bemerkenswert ist hierbei, dass es Paul VI. in seiner Ansprache damals nicht darum ging, das gerade tagende Zweite Vatikanische Konzil in einen umfassenden kirchlichen und konziliaren Traditionsstrom einzubetten, sondern etwas sehr praktisches, pragmatisches und konkretes aufzuzeigen, nämlich die Möglichkeiten und Grenzen der Kurienreform, freilich von den theologischen, speziell ekklesiologischen Vorhaben und Vorgaben des Konzils her. Zu diesem thematischen Bogen schrieb Joseph Ratzinger zusammenfassend: „Überlegt man alledies, so darf man ohne Weiteres sagen, dass die Kurienrede des Papstes einen bedeutsamen und neuen geschichtlichen Schritt darstellte, der dem Konzil die Freiheit der Diskussion auf einem Gebiet sicherte, das von seiner Lage im Grenzbereich zwischen episkopaler und primatialer Gewalt her notwendig einen besonders delikaten Charakter erhält. Auf der anderen Seite bleibt freilich zu sagen, dass diese Rede, obzwar ein neuer Schritt, dennoch keinen Bruch mit dem Bisherigen bedeutet. Denn das Konzil ist zwar zu Vorschlägen, nicht aber zu Beschlüssen in dieser Sache aufgefordert, so dass die letzte Entscheidung doch beim Papste bleibt, auch wenn das Konzil beteiligt wird. Behält man diesen Tatbestand im Auge, so wird man auch die Dezentralisierungsmaßnahmen des Papstes am Ende der Sitzungsperiode richtig einordnen, die genau aus dieser Verbindung von wagendem Schritt in das Neue hinein und von Kontinuität mit dem Vergangenen hervorgewachsen sind, die wir der Rede vom 21. September im Ganzen entnehmen müssen. Ja, man darf wohl sagen, dass damit die Position des Papstes gegenüber dem Konzil überhaupt bezeichnet ist. Alles, was im Folgenden von ihm her geschehen ist, trägt diese gleiche Signatur: die Bereitschaft, dem Kommenden und Neuen entgegenzugehen, aber es stets in der Verbindung mit der Kontinuität der Geschichte zu tun. Bei allem Unterschied der Temperamente ist diese Haltung wohl nah verwandt mit der Johannes‘ XXIII., der von sich gesagt haben soll, er sei sowohl der Papst derer, die auf den Gashebel, wie derer, die auf das Bremspedal treten“ (ders., ebd., S. 363).
Dieser Kommentar ist in meiner Sicht hochinteressant für den Kontinuitätsbegriff Ratzingers, denn in der Art, wie er damit die Ausführungen Pauls VI. interpretiert, haben wir in der Tat bereits alle Elemente des Kontinuitätsbegriffs der Weihnachtsansprache aus 2005 beisammen, beziehungsweise die Möglichkeit, Benedikts Reformhermeneutik richtig zu verstehen, ohne dabei eigene Präferenzen hineinzudeuten: Wenn auch die Reform als Gegensatz zu Bruch und Diskontinuität beschrieben wird, ist Reform nicht homogene Kontinuität, sondern ist aus der „Verbindung von wagendem Schritt in das Neue hinein und von Kontinuität mit dem Vergangenen hervorgewachsen.“ Sie trägt die Signatur der „Bereitschaft, dem Kommenden und Neuen entgegenzugehen, aber es stets in der Verbindung mit der Kontinuität der Geschichte zu tun.“ Wichtig ist also für Ratzinger durchaus der Anspruch, Faktum oder Anschein des Bruches auszuschließen, wie ich in einem früheren Beitrag schon sagte, schließt das aber gewisse, legitime Diskontinuitäten für ihn keineswegs aus. So glaube ich, dass man dieser Stellungnahme Ratzingers zur Kurienansprache Pauls VI. vom 21. September 1963 grundsätzlich den generellen Kontinuitätsbegriff Benedikt XVI. zu seiner Reformhermeneutik entnehmen muss, um ihn nicht als Traditionalisten misszuverstehen, sei es, weil man sich ihn als Traditionalisten gewünscht, sei es, weil man ihn deshalb abgelehnt hat, weil man ihn für einen Traditionalisten gehalten hat. Aus der Synthese von wagendem Schritt und dem gleichzeitigen Stehen in Kontinuität wächst für Ratzinger Reform hervor. Dieses Wachstum greift wiederum das Bild eines organischen Werdens und Entstehens auf, wodurch Brüche als anorganisch zurückgewiesen werden, nicht jedoch die Vorstellung vitaler Entwicklung ausgeschlossen wird, die auch berechtigt Neues aufgreifen kann und selbst legitim Neues hervor- und in die weitere Entwicklung einbringen darf.
Kontinuität konkret
Wie gesagt, wendet Ratzinger den so konstruierten Kontinuitätsbegriff ganzheitlich an. Dennoch sollte man nicht übersehen, welchem konkreten Kontext er entnommen wurde: der Aufgabenstellung konziliarer Kurienreform – die Paul VI. dem Konzil auftrug. Das ist sicher nicht zufällig, wenn man weiß und bedenkt, welchen Stellenwert das Verhältnis von Episkopat und Primat im theologischen Denken Joseph Ratzingers auf dem Konzil einnahm. Er sprach in seiner Berichterstattung über die Konzilsdebatte über Bischofskonferenz, Bischofsrat und Kurienreform von einer zentrifugalen Tendenz einerseits und andererseits von einer zentripetalen Tendenz, wobei er die zentrifugale Linie folgendermaßen beschreibt: Sie strebe „darnach, dass die Bischöfe eine Reihe von Vollmachten, die bisher auf den Päpstlichen Stuhl konzentriert waren, als normalen Bestandteil ihres bischöflichen Amtes zuerkannt erhalten und durch die so erreichte Dezentralisierung die einzelnen geistigen Räume in der Kirche ein entsprechendes Maß an Selbständigkeit entwickeln können, die nicht durch fortwährend nötige Rückfragen an Rom ungebührlich eingeengt wird“ (vgl. ders., ebd., S. 386). In dieser Schilderung spricht sich deutlich Ratzingers Zustimmung aus, und äußert er sich an anderer Stelle direkt zum Stichwort Kurienreform:
„Es gilt aus dem Gesagten, die miteinander vermengten Bereiche – römische Orts-Kirche und Gesamtkirche, Primat und Patriachat ohne Verletzung des Primats zu entflechten und den Organismus der Ortskirchen wieder lebensfähig zu machen sowie das lateinische Patriarchat in seiner gegenwärtigen Extension aufzulösen und durch eine Mehrzahl patriarchaler Räume zu ersetzen. Unter ‚patriarchalen Räumen‘ sind dabei nicht etwa neue Patriarchate zu verstehen, gegen deren Bildung vieles spricht, sondern Regionen, deren Selbständigkeit ungefähr derjenigen der früheren Patriarchate entsprechen sollte, deren Leitung aber bei der jeweiligen Bischofskonferenz liegen könnte, die natürlich ihrerseits dem Gesamtkollegium der Bischöfe und dem Papst verantwortlich bleiben müsste“ (ders., ebd., S. 352). Zur zentrifugalen Linie tritt die von Ratzinger so genannte, zentripetale hinzu, die er in einer Art Bischofsrat repräsentiert sieht, dessen Bildung anzustreben sei, um die Weltkirche und das Bischofskollegium an der römischen Kurie zu vertreten. Ratzinger sucht dann für einen solchen Bischofsrat historische Vorbilder und theologische Begründungen, wobei zu erkennen ist, dass sein Motiv darin besteht, die Kollegialität der Bischöfe gemäß Vaticanum II institutionell in der Struktur und Organisation der Kirche zu konkretisieren (vgl. ders., ebd., S. 352-355). Wenn man das bedenkt und auch nicht vergisst, dass Benedikt XVI. als Papst den Titel des Patriarchen des Westens persönlich abgelegt und in Zukunft gestrichen hat, erkennt man, dass das weit mehr war als etwa eine ökumenische Reverenz an die Adresse der Orthodoxie, sondern die Ermöglichung, die Schaffung neuer patriarchaler Räume praktisch anzugehen.
Warum stelle ich diese Zusammenhänge hier heraus? Um aufzuzeigen, dass tatsächlich eine immense theologisch-thematische und auch praktisch-konkrete Übereinstimmung zwischen Papst Franziskus und Benedikt XVI. besteht. Diese Kontinuität ist allerdings weniger Konformität mit der Tradition in einem umfassenden Sinne als vielmehr Kontinuität mit dem Zweiten Vaticanum. Reformhermeneutik, die wirklich im Sinne Ratzingers verstanden und vollzogen wird, transformiert wahrscheinlich letztlich Tradition zu kontinuierlicher Transition. Eine Transformation, die Ratzinger theoretisch entwickelt hat und die Papst Franziskus sich nun anschickt, praktisch umzusetzen.
In Richtung dieser Vermutung weist auch, dass viele, die sich als treue Gefolgsleute der Hermeneutik der Reform in Kontinuität verstanden, die Nota explicativa praevia vom 16. November 1964 als ganz entscheidenden Schlüsseltext zu dieser Hermeneutik aufgefasst haben. Sie verschweigen oder wissen nicht, dass der Theologe Ratzinger die Bedeutung dieses Textes gezielt relativiert hat – sowohl mit formalen, als auch inhaltlichen Argumenten. Unter anderem schreibt er: „Die offene Aufgabe, die das Konzil hinterlässt, wird im Zwielicht der ‚Erläuternden Vorbemerkung‘ (wie man den Titel der Nota im Deutschen wiedergegeben hat) überraschend deutlich. Es stehen sich gegenüber einerseits ein Denken, das von der ganzen Breite der christlichen Überlieferung ausgeht und von ihr aus die ständige Weite der kirchlichen Möglichkeiten zu beschreiben sucht; auf der anderen Seite ein rein systematisches Denken, das allein die gegenwärtige Rechtsgestalt der Kirche als Maßstab seiner Überlegungen zulässt und so jede Bewegung über sie hinaus als einen Sturz ins Bodenlose scheuen muss: Ihr Konservativismus beruht auf ihrer Geschichtsfremdheit und so im Grunde auf einem Mangel an Tradition, nämlich an Offenheit für das Ganze der christlichen Geschichte. Das zu sehen, ist wichtig, weil es eine Einsicht in die innere Gestalt des konziliaren Richtungsansatzes gestattet, den man fälschlich als das Gegenüber von Progressisten und Konservativen beschrieben hat. Richtiger würde man von einem Gegensatz zwischen geschichtlichem und systematisch-juridischem Denken sprechen: Den ‚Progressisten‘ (wenigstens dem überwiegenden Teil von ihnen) ging es in Wahrheit gerade um die ‚Tradition‘, um die Selbstbesinnung auf die Weite und den Reichtum der christlichen Überlieferung hin (ders., ebd., S. 455).
Die Progressisten sind also für Ratzinger diejenigen, die eigentlich für die Tradition einstehen, die Traditionalisten letztlich Positivisten, die eine Momentaufnahme der Vergangenheit, insofern sie für die gegenwärtige Rechtsgestalt der Kirche maßgeblich ist, irrtümlich für die Tradition halten. Ich weise auf diesen Sachverhalt hin, um zu zeigen, dass Ratzinger sich selbst eher den Progressiven zuordnen würde, weil er ihnen die Weite und Breite der Tradition zuschreibt. Die autoritär-positivistische Verengung des Blicks auf die Tradition, die Ratzinger bei den Konservativen sieht, mag eine tatsächliche Versuchung sein, doch die Pauschalität der Umkehrung, in der die Progressiven zu den eigentlichen Traditionstreuen werden, ist in dieser Form nicht akzeptabel, vor allen Dingen nicht, weil Ratzinger übersieht oder übergeht, wie die gegenwärtige Rechtsgestalt der Kirche sich wohl einem geschichtlichen Werdegang verdanken mag, der an manchen Scheidepunkten vielleicht auch hätte anders verlaufen können, in einer konkret geschichtlichen Gestalt aber auch dogmatisch fixiert wurde und somit für die Zukunft irreversibel verbindlich ist. Besonders deutlich wird das gerade am Ersten Vaticanum mit den Dogmen von Jurisdiktionsprimat und Unfehlbarkeit des Papstes. Möglicherweise verschwieg Ratzinger das sogar in vollem Bewusstsein darüber, dass das Zweite Vaticanum gerade deshalb mittels seiner Lehre vom Bischofskollegium keine wirkliche dogmatische Balance zwischen Primat und Episkopat würde bewirken können, weil es darauf verzichtete, seinerseits die Kollegialität ebenso dogmatisch zu definieren, wie vorher das Erste Vaticanum Primat und Unfehlbarkeit des Papstes dogmatisiert hatte.
Konstruierte Gegensätze – überraschende Übereinstimmung
Der medial konstruierte Gegensatz zwischen Papst Franziskus, dem Progressiven und Benedikt, dem Konservativen oder gar Traditionalisten besteht nicht, sondern in seinem Selbstverständnis und -anspruch ist Benedikt XVI. selbst progressiv. Die Übereinstimmung und Kontinuität zwischen beiden besteht in Themen des Zweiten Vaticanums und in deren praktischer Implementierung. Ganz besonders und konkret zweifellos in puncto Kurienreform. Durch subtile Umkehrung der Etiketten nimmt Ratzinger für die Progressiven den breiten Strom der Tradition in Anspruch, während bei den Konservativen durch Verengung der Perspektive davon nur noch ein spärliches Rinnsal übrigbleibe. Blenden wir abschließend zurück auf die bereits zitierte Bemerkung Ratzingers über Paul VI. und Johannes XXIII.: „Bei allem Unterschied der Temperamente ist diese Haltung (gemeint ist die Synthese aus wagendem Schritt ins Neue hinein und Verbindung mit der Kontinuität der Geschichte bei Paul VI., Anm. C.V.O.) wohl nah verwandt mit der Johannes‘ XXIII., der von sich gesagt haben soll, er sei sowohl der Papst derer, die auf den Gashebel, wie derer, die auf das Bremspedal treten“ (ders., ebd., S. 363).
Alles in allem kann man annehmen, dass Benedikt XVI. gerne ebenfalls ein solcher Papst sein wollte. Wenn Ratzinger vom Unterschied der Temperamente zwischen Johannes XXIII. und Paul VI. bei gleichzeitig bestehender Übereinstimmung in der Grundhaltung sprach, lässt sich dasselbe analog von Benedikt und Franziskus sagen. Aber nicht in der naiven Behauptung, nur der Stil unterscheide beide, in allem wesentlichen sei Kontinuität gegeben. Von unterschiedlichen Temperamenten zu sprechen, ist auch hier viel sinnvoller, und die Kontinuität, die zwischen beiden gegeben ist, besteht mit dem Zweiten Vaticanum. Die Kontinuität, die eigentlich entscheidend wäre – jene des Zweiten Vaticanums mit den vorangegangenen Konzilien – wurde von Benedikt XVI. zwar postuliert (weil nicht sein kann, was nicht sein darf: der Bruch), aber in den wirklich strittigen Punkten nie bewiesen, sondern stets nur behauptet. Hierin näherte er sich dem Positivismus, den er den Traditionalisten unterstellte, nur dass seine Denkfiguren es ihm versagten, über die Rechtsgestalt, die das Zweite Vatikanische Konzil geschaffen hatte, hinauszugehen und dadurch tatsächlich wieder die Weite und Breite der Tradition zu entdecken.
Doch was von Benedikt bleibt, wird der wagende Schritt ins Neue hinein sein, den er mit seinem Amtsverzicht gesetzt hat, um das Papsttum einer zentrifugalen und zentripetalen Transformation zu öffnen, wie sie das Zweite Vaticanum mit der – unerreichten – Balance zwischen Primat und Episkopat angestoßen hat. Dieser Transformation gibt Benedikt zusammen mit Franziskus weiteren Auftrieb, indem gemeinsame Auftritte zweier Päpste – wie wiederum zum Fest Petri Stuhlfeier und erstmals sogar im Petersdom – das Papstamt subtil relativieren und seiner Einzigartigkeit berauben. Zumindest medial. Doch nichts ist heutzutage in der allgemeinen Wahrnehmung und Wirksamkeit effektiver. Vom virtuellen Konzil zum virtuellen Papsttum, von der verbindlichen Tradition zur beständigen Transition.
Foto: Statue des hl. Petrus – Bildquelle: Kathnews