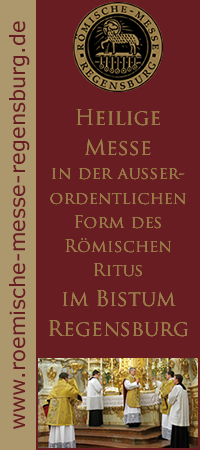11. Oktober 2012. Impulse zum 50. Jubiläum der feierlichen Eröffnung des II. Vatikanischen Konzils
Aus der berühmten Ansprache des Heiligen Vaters vom 22. Dezember 2005 wird meist nur der Passus zitiert, dem sich die Begriffsprägung einer „Hermeneutik der Diskontinuität oder des Bruches“ beziehungsweise „der Reform“ entnehmen lässt, oder es werden daraus überhaupt nur diese Begrifflichkeiten übernommen, um davon ausgehend die weniger komplexe, dafür eingängigere „Hermeneutik der Kontinuität“ zu entwickeln, die freilich eine Homogenität des Denkansatzes Benedikts XVI. suggerieren könnte, die dieser Ansatz ursprünglich und im Original nicht besitzt.
Konzilskritik einst und jetzt
Früher schon habe ich die Konzilskritik eines Basilius von Caesarea angeführt, die Ratzinger im Epilog seiner Theologischen Prinzipienlehre nur kurz streift. In seinen Ausführungen zur Konzilshermeneutik stellt Benedikt XVI. sie ausführlicher dar: „Welches Ergebnis hatte das Konzil? Ist es richtig rezipiert worden? Was war an der Rezeption des Konzils gut, was unzulänglich oder falsch? Was muss noch getan werden? Niemand kann leugnen, dass in weiten Teilen der Kirche die Konzilsrezeption eher schwierig gewesen ist, auch wenn man auf das, was in diesen Jahren geschehen ist, nicht die Schilderung der Situation der Kirche nach dem Konzil von Nizäa, die der große Kirchenlehrer Basilius uns gegeben hat, übertragen will: Er vergleicht die Situation mit einer Schiffsschlacht in stürmischer Nacht und sagt unter anderem: ‚Das heisere Geschrei derer, die sich im Streit gegeneinander erheben, das unverständliche Geschwätz, die verworrenen Geräusche des pausenlosen Lärms, all das hat fast schon die ganze Kirche erfüllt und so durch Hinzufügungen oder Auslassungen die rechte Lehre der Kirche verfälscht …’ (vgl. De Spiritu Sancto, XXX, 77; PG32, 213 A; SCh 17bis, S. 524).
Wir wollen dieses dramatische Bild nicht direkt auf die nachkonziliare Situation übertragen, aber etwas von dem, was geschehen ist, kommt darin zum Ausdruck. Die Frage taucht auf, warum die Rezeption des Konzils in einem großen Teil der Kirche so schwierig gewesen ist. Nun ja, alles hängt ab von einer korrekten Auslegung des Konzils oder – wie wir heute sagen würden – von einer korrekten Hermeneutik, von seiner korrekten Deutung und Umsetzung. Die Probleme der Rezeption entsprangen der Tatsache, dass zwei gegensätzliche Hermeneutiken miteinander konfrontiert wurden und im Streit lagen. Die eine hat Verwirrung gestiftet, die andere hat Früchte getragen, was in der Stille geschah, aber immer deutlicher sichtbar wurde, und sie trägt auch weiterhin Früchte. Auf der einen Seite gibt es eine Auslegung, die ich ‚Hermeneutik der Diskontinuität und des Bruches’ nennen möchte; sie hat sich nicht selten das Wohlwollen der Massenmedien und auch eines Teiles der modernen Theologie zunutze machen können. Auf der anderen Seite gibt es die ‚Hermeneutik der Reform’, der Erneuerung des einen Subjekts Kirche, die der Herr uns geschenkt hat, unter Wahrung der Kontinuität; die Kirche ist ein Subjekt, das mit der Zeit wächst und sich weiterentwickelt, dabei aber immer sie selbst bleibt, das Gottesvolk als das eine Subjekt auf seinem Weg.
Die Hermeneutik der Diskontinuität birgt das Risiko eines Bruches zwischen vorkonziliarer und nachkonziliarer Kirche in sich.“ Damit ist ein größerer Kontext der beiden hermeneutischen Zugangsweisen zum II. Vatikanischen Konzil angegeben, und auch, wenn der Heilige Vater die Konzilskritik des Basilius vornehm als zu drastisch nicht auf das II. Vaticanum übertragen will, so erwähnt er sie doch ganz gewiss nicht ohne Hintergedanken. Es fällt auf, dass Benedikt XVI. sehr deutlich macht, wie die Mehrheitsverhältnisse liegen: Die Rezeption des II. Vatikanischen Konzils war in einem großen Teil der Kirche schwierig, die Hermeneutik des Bruchs genoss das Wohlwollen der Massenmedien. Der Papst fügt dann das Wohlwollen eines Teiles der modernen Theologie an, wobei er diplomatisch darauf verzichtet, das Adjektiv ‚groß’ abermals zu nennen. Dieser Hermeneutik ist das Ergebnis zugeordnet, Verwirrung gestiftet zu haben, während die Hermeneutik der Reform in Stille geschehen sei, aber Früchte getragen habe und weiterhin trage. Aus dem Kontext ist ganz klar, dass in der Wahrnehmung und nach dem Urteil Benedikts XVI. die rechte Hermeneutik und Rezeption des II. Vaticanums nach dem Konzil in der Kirche nur von einer Minderheit angewandt worden ist.
Diese Minderheit kann freilich nicht bei jenen liegen, die ebenfalls eine Bruchhermeneutik betrieben haben, indem sie das II. Vatikanische Konzil pauschal und undifferenziert als eine einzige, große Diskontinuität kritisiert haben. Benedikt XVI. hat seine Überlegungen kurz vor Weihnachten 2005 angestellt. Das war noch relativ kurz, nachdem er Papst geworden war, geschah bei seiner ersten Weihnachtsansprache als Nachfolger Petri und kann insofern als programmatisch gelten. Der äußere Anlass war aber der 40. Jahrestag des Abschlusses des Zweiten Vatikanischen Konzils am 8. Dezember 1965. 2012 sieht heute den 50. Jahrestag seiner Eröffnung am 11. Oktober 1962, und deshalb erscheinen diese Zeilen. Der Papst hat die Mehrheitsverhältnisse von Bruchhermeneutik und Reformhermeneutik in der Nachkonzilszeit in der Vergangenheitsform dargestellt.
Wenn wir die Situation nüchtern betrachten, muss man darin nach wie vor das päpstliche Desiderat erkennen, dass in Zukunft die Hermeneutik der Reform wirkungsvoll werde und – wenn nicht alle – so doch den Großteil der Kirche erfasse und überzeugen möge. Die Hermeneutik der Kontinuität trägt zweifellos Früchte, doch nach wie vor reifen sie überwiegend in der Stille und im Verborgenen. Das heißt nicht, dass es unbedingt wünschenswert wäre, dass sie sich im heiseren Geschrei und Geräusch der Verwirrung dadurch durchsetzt, dass sie selbst laut wird. Sie muss überzeugen, und wer schreit, überzeugt niemanden. Freilich muss man außerdem nüchtern hinzufügen, dass es nicht nur die akademische Theologie oder große Teile davon waren, die einer Bruchhermeneutik huldigten. Auch Bischöfe sind Theologen und wurden und werden von dieser Hauptströmung der universitären Theologie mit geprägt, Bruchhermeneutik wurde und wird bis in die kleinste Pfarrei hineingetragen, prägt vielleicht sogar ganz besonders die kirchlichen Gremien und die „engagierte Basis“.
Abnutzung und Unklarheit von „Tradition“
Trotzdem wird in der katholischen Kirche insgesamt, und das ist vermutlich das eigentliche Problem einer Hermeneutik der Reform in Kontinuität, zu oft und zuviel über Tradition gesprochen. Dieses Problem potenziert sich gerade in den Kreisen der Kirche, die für sich dezidiert eine besondere Traditionstreue in Anspruch nehmen oder sich darum bemühen. Dass das ein Problem ist, liegt daran, dass dadurch das Wort „Tradition“ abgenutzt und verbraucht wird und gleichzeitig ein ungenau gebrauchter oder sogar unklarer Begriff ist. Zu einer entsprechend notwendigen Klärung und Präzision des Traditionsbegriffs beizutragen, ist deshalb schon bisher das Anliegen aller meiner Beiträge zum Traditionsbegriff und zur Konzilshermeneutik gewesen. Es gibt die Sichtweise, die Tradition sei deswegen lebendig, weil sie das Leben der Kirche sei und deswegen sei sie notwendigerweise ebenso lange lebendig, wie die Kirche selbst lebt. Das scheint ganz richtig zu sein, und doch wird die inhaltliche Vollendung der Offenbarung, deren Bedeutung hier immer wieder betont worden ist, bei dieser Argumentation dazu benutzt, im Leben der Kirche zwei Phasen zu unterscheiden: Offenbarung, die damit irgendwie der Vergangenheit anheimfällt und Tradition, die seitdem andauert und so die ständige Gegenwart der Kirche bildet.
Bei solcher Sicht kann die Tradition ausschließlich und notwendigerweise als lebendig betrachtet werden, und sogar jede rein profane Tradition ist als Prozess der Weitergabe ja auch tatsächlich notwendig lebendig. In dem Moment, wo sie abgeschlossen oder abgebrochen wird, kommt sie zum Erliegen und erlischt. Jede Weitergabe ist indes auf eine Gabe angewiesen, die sie weitergibt. In der Vorstellung zweier Phasen im Leben der Kirche, Offenbarungsphase und Überlieferungsphase, wird die Tradition zu stark von ihrem wesentlichen Inhalt, von ihrer Substanz, unterschieden und damit unnatürlich davon getrennt. Die Tradition ist im Wesentlichen aber gerade deshalb notwendig lebendig, damit (!) die Offenbarung Jesu Christi in ihrer apostolischen Gestalt, die immer besser erkannt, aber nicht mehr verändert werden kann, niemals zur Vergangenheit wird, sondern immer pneumatisch gegenwärtig ist. Tradition ist also nicht inhaltsleer oder bloße Gewohnheit.
Traditionen – unter Umständen Rahmenerscheinungen und Nebenprodukte der Tradition
Trotzdem gibt es neben diesem substantiellen Gehalt, der durchaus mit der Offenbarung Jesu Christi zu identifizieren ist, Nebenprodukte oder Rahmenerscheinungen, die, wenn sie sich einmal gebildet haben, tatsächlich nicht unbedingt immerfort mitgeführt werden müssen. Diese Traditionen können im Lauf der Geschichte der Kirche auch wieder zurückgelassen oder verabschiedet werden, wenn neue, gleichfalls vorübergehende, Nebenprodukte und Rahmenerscheinungen an ihre Stelle treten. Diese Aspekte sind ein Grund für das Verständnisproblem des Traditionsbegriffs. Indem sie nur als Prozess gesehen wird, drängt die Lebendigkeit der Tradition ihre Substanz in den Hintergrund oder trennt sie im Extremfall sogar davon. So entleert, verbleiben der Tradition nur noch nebenwesentliche Inhalte, die schnell als unwesentlich erscheinen.
Das kann die letzte Folge sein, wenn man eine Offenbarungs- und eine Traditionsphase unterscheidet, wenn man auch sagt, dass die Tradition auf der Offenbarung aufbaue, denn indem die Tradition weiterbaut, beruht sie zwar auf ihrem Fundament, das zwar als der feste Grund des ganzen Bauwerks gewissermaßen in allen seinen Etagen gegenwärtig bleibt, entfernt sich aber zugleich auch immer weiter von diesem Fundament. Ist die Offenbarung nur Fundament der Tradition, nicht aber ihr wesentlicher, stets unmittelbar gegenwärtiger Inhalt, wird der Eindruck mächtig, die Tradition der Kirche bestehe überhaupt nur aus verstaubten Gewohnheiten, die mit unserem Leben nichts mehr zu tun haben. Benedikt XVI. sieht dieses Verständnis bei den Bruchhermeneutikern bis in deren Lektüre der Konzilstexte hinein wirksam. Die Kompromissformeln der Texte hätten in dieser Lesart viele alte und inzwischen nutzlos gewordene Dinge mitschleppen und wieder bestätigen müssen, um zum Neuen als dem Eigentlichen vorstoßen zu können. In der Zeitstimmung der 1960iger Jahre und danach mag in der Konzilsrezeption ein solcher Eindruck entstanden sein.
Kontinuität als Medium von Reformhermeneutik
Auf der Grundlage eines geklärten Traditionsbegriffes kann dann auch erkannt werden, dass Kontinuität das Medium der Hermeneutik der Reform ist, die die Selbstvergewisserung der Identität von Glaube und Kirche in Wandel und Bewährung zum Ziel haben muss. Was in Wandel und Bewährung zusammenwirkt, das sind nach Benedikt XVI. Treue und Dynamik. Kontinuität zielt auf Identität, bestätigt sich in ihr, und Identität ist in dieser Kontinuität zu beweisen, wie der Papst in seiner Ansprache ausgehend vom Beispiel zeitbedingter Rahmenbedingungen und Anwendungen der Religionsfreiheit sagt: „Das Zweite Vatikanische Konzil hat durch die Neubestimmung des Verhältnisses zwischen dem Glauben der Kirche und bestimmten Grundelementen des modernen Denkens einige in der Vergangenheit gefällte Entscheidungen neu überdacht oder auch korrigiert, aber trotz dieser scheinbaren Diskontinuität hat sie ihre wahre Natur und ihre Identität bewahrt und vertieft.“
Traditionalistische Einwände
Traditionalistische Kritik wendet hier oft ein, auch wenn man wisse, dass ein katholischer Staat im Moment nicht praktikabel sei, müsse die katholische Kirche im Prinzip den Anspruch auf den katholischen Staat jedenfalls aufrechterhalten. Das scheint mir zu übersehen, dass der Begriff des Staates einen entscheidenden Wandel vollzogen hat. Alle klassischen Staatstheorien haben im Staat eine metaphysische Größe oder den Staat metaphysisch legitimiert gesehen. An dieser Stelle (!) ist ein Bruch eingetreten. Es geht im postmodernen Staat nicht mehr darum, welche Staatsreligion ein Staat hat. Die Neutralität des Staates ist inzwischen konsequent durchgeführt. Das kann man kritisieren und bedauern, der real existierende Staat ist nicht mehr das, was wir klassisch als Staat bezeichnet haben.
Beide Positionen benutzen dasselbe Wort und sagen „Staat“, klassisch ist damit eine Idee verbunden, aktuell nur noch das praktische Erfordernis einer geordneten Gesellschaft oder überhaupt ein bloßes Faktum. In dieser Situation ist ein Eintreten für Religionsfreiheit gerade ein Einsatz für den Anspruch des Metaphysischen und reklamiert für diesen Anspruch einen Freiraum, der sonst vom Neutralen völlig absorbiert werden würde. In diesem Anspruch für das Metaphysische besteht die Kontinuität. Die wesentliche Identität der Haltung der Kirche zur Religionsfreiheit wird dabei gerade dadurch gewahrt, dass das Lehramt der Kirche auf eine veränderte Situation und Realität auf neue Weise angemessen reagiert. Noch offensichtlicher als beim Staat ist ein analoges Phänomen beim Begriff „Ehe“, bei dem katholische Idee und staatliches Faktum ebenfalls nicht mehr zur Deckung kommen oder zu vermitteln sind.
Kontinuität muss Identität sichtbar werden lassen
Kontinuität ist also kein Mantra, nicht Selbstzweck oder Beruhigungsmittel, sondern muss Identität erkennbar machen. Nicht jeder Wandel ist der Bruch, der Identität angreift, und es kann den Wandel geben, durch den Identität bewahrt wird und sich bewährt. Kontinuität meint Bestätigung von Identität, zugleich ist sie dann dem Wandel gegenüber aufgeschlossen, wenn ohne (!) ihn ein Bruch sich ereignen würde, an dem Identität zerbricht.
Foto: Papst Benedikt XVI – Foto: Kathnews